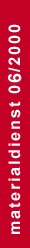Eine zutiefst zerrissene Gesellschaft
Die zionistische Ideologie hat ihre Kittfunktion verloren über die Friedensfähigkeit des israelischen Staates
von Moshe Zuckermann
Der Zionismus als staatstragende Ideologie verliert für die israelische Gesellschaft zunehmend seine verbindende Wirkung. Wie sich das auf die israelische Kultur und auf die Friedensfähigkeit des Landes auswirkt, hat Moshe Zuckermann in einem Beitrag für die in Freiburg erscheinende Dritte Welt-Zeitschrift iz3w (auch im Internet unter: www.iz3w.org). untersucht. Wir dokumentieren seinen Text leicht gekürzt. Moshe Zuckermann ist Soziologe und Historiker an der Universität Tel Aviv. Als Israels Premierminister Barak zu dem von Clinton einberufenen Gipfel mit Arafat reiste, hatte er seine Mehrheit im Parlament verloren. Diese Konstellation ist schlüssig. Denn während sich Israel dem (wie auch immer motivierten) Drängen der USA nach einer Friedensregelung im Nahen Osten nicht entziehen kann, ist es in seiner (wie immer ernst gemeinten) Friedenswilligkeit gelähmt. Das heißt, wohl will Israel den Frieden, nicht ganz klar ist jedoch, ob es auch bereit wäre, den dafür zu entrichtenden "Preis" zu bezahlen. Die Lähmung ist dabei keine Frage eines monolithischen Wollens bzw. einer homogenen Staatsentscheidung, sondern rührt von einer strukturellen Zerrissenheit her, die das Land seit längerer Zeit nicht nur in der Friedensfrage durchsetzt. Diese Zerrissenheit ist als Folge der sich nach und nach abschwächenden Kittfunktion der zionistischen Ideologie in ihrer Bedeutung als staatstragender Ideologie Israels zu verstehen. Hatte der Zionismus ideologisch die Negation der jüdischen Diaspora und die Erschaffung des "Neuen Juden" in einer eigens dafür zu errichtenden Heimstätte postuliert, so bedeutete dies für die Errichtung des Staates und die Entfaltung der neuen Gesellschaft, dass ein für die aus aller Herren Länder zusammengeführten Diaspora- und Exilgemeinschaften geschaffener gemeinsamer Nenner unabdingbar wurde. Den Gegensatz zwischen der modernen jüdischen Säkularität bei gleichzeitiger Berufung auf das religiös jüdische (Ur)erbe meinte der alles Partikulare überdeckende Zionismus überwinden zu können. Es gibt vielerlei Gründe für die Schwächung dieser Ideologie, unter denen jedoch die in den vergangenen Jahren an die Oberfläche gelangten Gegensätze, Widersprüche und die in ihnen wurzelnden Konfliktfelder der israelischen Gesellschaft wohl herausragen. Über Jahrzehnte konnten diese konfliktträchtigen Spannungen mehr oder weniger unter den Teppich dessen gekehrt werden, was als legitime Agenda der israelischen Außen- und (damit einhergehend) Innenpolitik ausgegeben wurde. Als etwa zu Beginn der 70er Jahre die so genannten "Schwarzen Panther" die Misere der von vorwiegend orientalischen Juden bevölkerten Jerusalemer Slums anprangerten und ihr Protest außerparlamentarisch sichtbar wurde, kanzelte die damalige Ministerpräsidentin Golda Meir sie als "nicht nett" ab. Bezeichnend war, dass der allergrößte Teil der israelisch-jüdischen Bevölkerung sich mit dieser "Einschätzung" durchaus identifizieren konnten: Gesellschaftliche Probleme wurden in der Rangordnung nationaler Prioritäten der "Sicherheitsfrage" untergeordnet, und wer darauf pochen zu können meinte, seine eigene soziale Misere als Strukturproblem der israelischen Gesellschaft darzustellen, war eben "nicht nett" - vor allem dann nicht, wenn er ein Araber oder ein Jude orientalischer Provenienz war. Dass Golda Meir kurze Zeit, nachdem sie ihre arrogante Äußerung gemacht hatte, Israel in einen seiner schlimmsten Kriege führte, beendete zwar ihre politische Karriere. Es sollte aber noch Jahrzehnte dauern, ehe die mit dem neu entstandenen "Sicherheitsproblem" - den militärischen und gesellschaftlichen Folgen des Yom-Kippur-Kriegs von 1973 - untergegangene soziale Frage wieder an die tagespolitische Oberfläche gelangen sollte.1. Religiöse, ethnische und soziale Krisen
In diesem Zusammenhang ist die Verzahnung des so genannten ethnischen mit dem sozialen Problem von Bedeutung. Ein Blick auf die Klassenschichtung der israelischen Gesellschaft lässt deutlich erkennen, dass Israels obere Schichten vorwiegend von aschkenasischen, d. h. aus (Ost)europa stammenden Juden, die unteren hingegen zum allergrößten Teil von orientalischen Juden, von Arabern und in den letzten Jahren auch zunehmend von Fremdarbeitern bevölkert sind. Dies lässt sich zwar aus der Chronologie der historischen Einwanderungswellen nach Palästina und späterhin nach Israel erklären, kann aber über die objektiv entstandene aschkenasische Hegemonie in vielen Bereichen des israelischen Lebens, und vor allem über das mit dieser hierarchischen Struktur einhergehende subjektive, ethnisch ausgereizte Ressentiment vieler orientalischer Juden gegenüber den aschkenasischen Eliten nicht hinwegtäuschen. Die überwiegend aschkenasische Dominanz im akademischen Bereich z. B. wird von der jüdisch-orientalischen Intelligenz in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen zum Teil als "westlicher Diskurs" attackiert, von den breiten Massen orientalischer Juden hingegen als eine ihnen "fremde Kultur" abgetan, der u. a. das religiöse Kulturgut entgegengehalten werden müsse. Auch die Spannung zwischen religiösen und säkularen Juden steigt. Zwar arrangierten sich alle zentralen Gruppen in Israels religiösem Block - ob nichtzionistische Orthodoxe oder antizionistische Ultraorthodoxe, ob Nationalreligiöse oder in den letzten Jahren auch Gruppen des Reformjudentums - mit dem Zionismus, und doch war es über Jahrzehnte allen Beteiligten klar, dass dieses Arrangement seine Gültigkeit nur unter eben diesem zionistischen Primat bewahren kann. Dieser trug indes nur, solange kein ernster, teils ideologisch unterfütterter Interessenkonflikt zwischen den verschiedenen Seiten eintrat. Seit dem 67er Krieg avancierten vor allem die besetzten Gebiete der palästinensischen Westbank zum politischen Erbteil der Nationalreligiösen, die in der Okkupation der Territorien die (verheißene) Rückkehr ins "Land der Urväter" sahen, mithin deren Besiedlung mit religiösen, teils messianischen Begründungen aufluden. In Folge der in den 80er Jahren merklich erstarkenden Orthodoxie in Israels politischer Sphäre "orthodoxierte" sich auch die religiöse Ausrichtung vieler Zionisten im traditionellen nationalreligiösen Lager. Die Orthodoxie ihrerseits "nationalisierte" sich zusehends (auch, aber nicht nur als Reaktion auf die unter den politisch-religiösen Zionisten stattfindenden Transformationen), was sich vor allem in der Intensivierung ihrer Beteiligung an Israels politischem Leben auswirkte. In den letzten Jahren erhob zudem das vorwiegend in den USA verbreitete Reformjudentum einen Anspruch auf gesteigerte Akzeptanz durch die israelischen politischen Institutionen, ein Anliegen, das für säkulare Juden kein Problem darstellt, umso mehr hingegen für das orthodoxe Establishment, welches sich dem Vordringen reformjüdischer Bestrebungen in Israel vehement widersetzt. Vor diesem Hintergrund markierte der Aufstieg der Schas-Partei Mitte der 80er Jahre eine bemerkenswerte Wende in Israels politischer Kultur. Allein schon ihr Anwachsen von anfänglich vier auf 17 Mandate bei den letzten Wahlen indiziert eine Anziehungskraft, die über gängige politische Konjunkturen hinausgeht. Schas bildet in der Tat das politische Sammelbecken für alle oben skizzierten Neuralgien: Es handelt sich um eine orthodoxe Partei, deren Klientel sich nahezu gänzlich aus orientalischen Juden, die den sozioökonomisch unterprivilegierten Gesellschaftsschichten entstammen, zusammensetzt. Ihr charismatischer geistiger Führer, Rabbiner Ovadia Yossef, dessen halachische Schiedssprüche von den Parteipolitikern strikt befolgt werden, zeichnet sich durch eine gemäßigte Einstellung in der Außen- mithin Friedenspolitik aus, befindet sich aber (vermittels der von ihm delegierten Knessetpolitiker) in krassem politischen Konflikt mit den säkularen Parteien, vor allem mit der linksliberalen Merez. Demgegenüber ist das Schas-Wahlvolk in außenpolitischen Fragen traditionell rechts gerichtet, entwickelte aber darüber hinaus den friedenswilligen Merez-Anhängern gegenüber regelrechte Hassgefühle, die sich durch Feindbilder des als reich, säkular und aschkenasisch rezipierten Gegners speisen. Ein weiteres Konfliktfeld entstand in den 90er Jahren, als mit dem Zusammenbruch der UdSSR eine Einwanderungswelle von zirka einer Million russischen Juden einsetzte (von denen freilich mehr als 30 Prozent Nichtjuden sein dürften). Diese massive Immigration zeichnet sich weder durch eine (wie immer verstandene) zionistische Motivation noch durch einen besonders starken Willen zu der allen vergangenen Einwanderungswellen abgeforderten "kulturellen" Integration aus, und sie veränderte Israels demographische Struktur und politische Landschaft von Grund auf. Mehr als fünfzig russischsprachige Presseeorgane wurden ins Leben gerufen, eigene Subkulturen etabliert, eine auf Werbung und Konsum sich stark auswirkende neue Zielgruppe hochgepäppelt, vor allem aber zwei Parteien für die Belange der sich in einem Zustand von Werteverlust und Werteverunsicherung befindlichen Einwanderer gegründet. Die Wähler dieser beiden "russischen" Parteien sind nicht gerade ideologisch, sondern eher pragmatisch und betont interessengeleitet ausgerichtet. Dennoch tendieren ihre Positionen in außenpolitischen und Friedensfragen zumeist nach rechts. Da sich unter ihnen (teils in Folge der in der ehemaligen Sowjetunion gebräuchlichen Ehen zwischen Juden und Nichtjuden, teils wegen der "als Juden" mitgekommenen nichtjüdischen Flüchtlinge eine große Menge von Nichtjuden befand, die orthodoxen Parteien jedoch auf ihre strikt halachische Konversion bestanden bzw. ihnen andernfalls das Judentum absprachen, entfachte sich zwischen den "russischen" und den orthodoxen Parteien (vor allem Schas) eine vehemente politische Gegnerschaft, die im letzten Wahlkampf in der Schlacht um das für den zivilen Personenstand zuständige Innenministerium kulminierte. Mittlerweile bestehen übergreifende Ressentiments gegenüber der russischen Bevölkerung, die die israelische Demographie von Grund auf verändert hat, dabei aber relativ gleichgültig gegenüber den allgemeinen innerisraelischen Belangen sind.2. Baraks Koalitionsmelange
Es sind diese unterschiedlich gelagerten Konfliktachsen, die in die Regierungskoalition Baraks eingegangen sind. Eine Koalition mit der ins Rechtsextreme ausschlagenden Partei der Nationalreligiösen ("Mafdal") sowie mit der "russischen" Einwanderungspartei des dem ehemaligen Ministerpräsidenten Netanjahu verpflichteten Scharanski ("Israel Ba'aliya") ist politisch keineswegs selbstverständlich - schon gar nicht, wenn sich in derselben Koalition auch die mit den "Russen" zerstrittene Schas-Partei und die mit dieser kollidierende Merez eingefunden haben. Baraks Entscheidung für eine solche Melange hatte aber gute Gründe: Zum einen war er durch die Erfahrung Rabins mit einer knappen Mehrheitsregierung traumatisiert, einer Regierung, die sich notwendigerweise auf die Stimmen der arabischen Parteien stützen musste, was bei den anstehenden "historischen" Entscheidungen hinsichtlich der Friedensregelung für viele Israelis "unerträglich" zu sein scheint. Dass in dem daher beinahe "selbstverständlichen" Ausschluss der arabischen Parteien aus der Regierungsbeteiligung und damit vom Friedensabkommen der "Juden" mit den "Arabern" antidemokratische, ja rassistische Töne mitschwingen, ist zwar vielen in der Arbeitspartei klar. Man beruft sich jedoch stets auf "Sachzwänge", die den "Mentalitäten" der israelischen politischen Kultur innewohnten und bei jeder wählerabhängigen Machtkonstellation mitbedacht werden müssten. Zum anderen war sich Barak der unter den Koalitionspartnern herrschenden Spannungen sehr wohl bewusst und beschloss daher nach seinem Wahlerfolg eine möglichst breite Koalitionsbasis zu schaffen, die ihm verschiedene Optionen zum Umbau der Koalition im Falle des Ausstiegs eines der Partner offenhalten würde. Dass er sich der nun eingetretenen Situation eines massiven Ausstiegs aus der Koalition würde stellen müssen, hat er freilich kaum vorausahnen können. Was immer die Beweggründe einer jeder der Baraks Regierung verlassenden Parteien sein mögen (die spezifischen Motivationen und Interessen unterscheiden sich in der Tat) - es ist jetzt eine Entscheidungsphase erreicht worden, in der sich wieder einmal erweist, dass die Rhetorik der (gesamt)israelischen Friedenswilligkeit nicht unbedingt mit der durch die Parteien repräsentierten Bereitschaft der Bevölkerung, den unumgänglichen "Preis" für den Frieden tatsächlich auch zu entrichten, einher geht. Dass dabei empfindliche Punkte, wie die massive Rückgabe von Gebieten, der Endstatus Jerusalems und die Abkommen bezüglich des Rückkehrrechts palästinensischer Flüchtlinge, berührt werden, ist nur die eine Seite dieses merkwürdigen Widerspruchs. Die andere betrifft den nie wirklich konsequent reflektierten Gesichtspunkt, dass ein aus erfolgreichem Vollzug der Friedensbeschlüsse hervorgehendes Israel nicht mehr das alte sein kann: Es wird unweigerlich einer immens komplexen Auseinandersetzung mit der neu entstandenen Lage ausgesetzt sein, mithin endgültig Abschied von altvertrauten Selbstbildern und tradierten Ideologien nehmen müssen. So manifestiert sich in der für Barak entstandenen misslichen Situation ein Stück israelischer Realität. Israel ist heute eine zutiefst zerrissene Gesellschaft, in der gegensätzliche Interessen, widersprüchliche Ideologeme und konfliktträchtige Feindbilder die tagespolitische Ordnung permanent aufwühlen und in fortwährende politische Turbulenzen stürzen. Das, was man vor einigen Jahrzehnten noch mit zionistischer Ideologie zu bewirken trachtete - die Errichtung einer durch "jüdische" Solidarität geprägten, "einheitlichen" Gesellschaft -, entpuppt sich zunehmend als Chimäre. Dies hat mehrerlei Gründe, hängt aber in erster Linie mit den schon in der klassischen Ideologie des Zionismus angelegten Widersprüchen und den aus ihnen hervorgegangenen Strukturproblemen zusammen: Israel kann schlechterdings nicht beanspruchen, ein demokratischer Staat all seiner Bürger zu sein, zugleich aber das Kriterium der Staatsangehörigkeit auf den ethnisch beschränkten Begriff des "Juden" basieren. Es kann darüber hinaus kein Staat der Juden sein wollen, ohne das Kriterium der religiösen Definition des Juden anzunehmen, was aber seinen von ihm selbst stets postulierten Säkularcharakter zwangsläufig in Frage stellen muss.3. Abschied vom Selbstverständnis
Auch die viel beschworene "Solidarität", welche sich über Jahrzehnte aus negativem Selbstverständnis, wie jüdischer Leidensgeschichte, Holocaust oder - immer wieder aktuell - Feindschaft der Nachbarländer ("Sicherheitsfrage") speiste, kann längerfristig nicht ihre Kittfunktion wahren, wenn sich zugleich die soziale Schere (bei längst obsolet gewordenem sozialistischen Gedankengut der prästaatlichen Ära) immer weiter öffnet und zudem lange beschwiegene ethnische Faktoren eine merkliche Polarisierung der Gesellschaft bewirken. Israel kann aber vor allem keinen Frieden erhoffen, wenn besetzte Gebiete weiterhin als "Land der Urväter" geheiligt werden, bzw. wenn diejenigen, die das politisch-militärische Problem messianisch-religiös aufladen, die Entscheidungsfähigkeit der Regierung in der Friedensfrage wesentlich zu determinieren vermögen. So lässt sich behaupten, dass keine der in der nächsten Zeit anvisierten Lösungen zur Beilegung des Konflikts im Nahen Osten an den hier dargelegten politischen Strukturproblemen, mithin an der wahrhaftigen Erprobung der israelischen Friedensbereitschaft vorbeigehen können wird.Frankfurter Rundschau, 27.09.2000