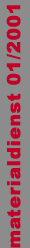Zur Vorgeschichte der Erklärung der EKD-Synode in Berlin-Weißensee vom 27. April 1950
von Johann Michael Schmidt
Die Vorgeschichte reicht in die Zeit des Kirchenkampfes zurück. Für die Initiatoren ging es darum, das damals Versäumte nachzuholen, in der Überzeugung, "etwas spät zu tun, ist noch immer besser, als es gar nicht zu tun" (M. Niemöller). Nach Ausbruch des Kirchenkampfes 1933 sind zahlreiche bekenntnishafte Erklärungen veröffentlicht worden. Unter ihnen ragt das Betheler Bekenntnis heraus: Er zielte darauf, die Deutschen Christen "vor die Bekenntnisfrage zu stellen" und grundlegend die Fronten zu klären. Dazu eignete sich besonders der Abschnitt "Die Kirche und die Juden" im VII. Teil "Von der Kirche". Ende August lag der Text vor; er wurde nach etlichen Änderungswünschen von Gutachtern z. T. erheblich abgeschwächt und so zum Jahreswechsel unter dem Titel veröffentlicht: "Das Bekenntnis der Väter und die bekennende Gemeinde. Zur Besinnung dargeboten von einem Kreise von evangelischen Theologen und in ihrem Namen herausgegeben von Martin Niemöller"" Der Abschnitt "Die Kirche und die Juden" beginnt mit der traditionellen, auf die aktuelle politische Situation zugespitzten Ersetzungslehre: "An die Stelle des .... von Gott unter allen Völkern zu Seinem Volk erwählten .... alttestamentlichen Bundesvolkes tritt nicht eine andere Nation, sondern die durch die in allen Völkern verkündigte Botschaft von Jesus Christus aus allen Völkern gesammelte Kirche". Mit dem sogleich anschließenden Bekenntnis zu Gottes Treue, "dass Er Israel nach dem Fleisch, aus dem Christus nach dem Fleisch geboren ist, trotz aller Untreue auch nach der Kreuzigung des Christus nicht verwirft", wird ein Weg geöffnet, der allerdings erst 1950 dazu führt, dass die Ersetzungslehre nicht weiter vertreten wird. Weitere Aussagen richten sich gegen die Verwerfung der Judenmission und gegen die geforderte Bildung eigener judenchristlicher Gemeinden. Darüber hinausgehende Kampfansagen gegen deutschchristliche Irrlehren wurden von Gutachtern abgelehnt und sind in die veröffentlichte Fassung nicht aufgenommen worden, so auch die Warnung vor "pharaonischen Maßnahmen", nämlich den "von Israel nach dem Fleisch bewahrten heiligen Rest" anzutasten. Die Auseinandersetzungen um den ersten Entwurf und die Veränderungen in der veröffentlichten Fassung vermitteln einen Eindruck davon, wieweit der innerkirchliche Streit um die "Judenfrage" sich zu Lasten der Juden ausgewirkt hat. Das hängt damit zusammen, dass die zentralen Streitfragen indirekt auch jüdische Glaubensinhalte treffen konnten: Der Streit um das Alte Testament, um die Offenbarung, um das Messiasverständnis, und direkt um die Judenmission und um die Frage, wer für die Lösung der damals allgemein so bezeichneten Judenfrage zuständig sei. Bestätigt wird dieser rückblickende Eindruck dadurch, dass in folgenden Erklärungen von Seiten der Bekennenden Kirche "die Judenfrage" ausgeklammert wurde, so auch in der Theologischen Erklärung von Barmen, Mai 1934. Ihre christozentrische Exklusivität ermöglichte sogar das Missverständnis, als richte sie sich auch gegen jüdisches Offenbarungs- und Glaubensverständnis. Eine weitere Bestätigung bietet der Umstand, dass es nach 1945 so lange gedauert hat, bis sich die EKD und ihre Gliedkirchen der theologischen Aufgabe gestellt haben, ihr Verhältnis zum jüdischen Volk geschichtlich und theologisch zu klären. In der Stuttgarter Schulderklärung des Rates der EKD vom Oktober 1945 wird der millionenfache Mord am jüdischen Volk in das "unendliche Leid" eingeschlossen gewesen sein, das "durch uns ... über viele Völker und Länder gebracht worden ist". Aber gerade das zeigt, dass die theologische Dimension der systematischen Vernichtung des Gottesvolkes Israel nicht erkannt worden ist. Initiativen zur Aufarbeitung der auch dann noch so bezeichneten Judenfrage und der Versäumnisse während des Kirchenkampfes gingen zunächst vorwiegend von Personen und Institutionen aus, die sich der Judenmission verpflichtet fühlten. Hier wirkte die Erfahrung des Kirchenkampfes nach, in dem das Eintreten für die Judenmission zu einer Bekenntnisfrage geworden war. Das aber konnte sie nur solange sein, als der Kampf gegen die Judenmission judenfeindlich begründet und mit (kirchen)-politischer Macht durchgesetzt wurde. Dem Drängen von A. Freudenberg, Flüchtlingssekretär des ÖRK, war es wohl zu verdanken, dass im Frühjahr 1947 die Kirchenkanzlei der EKD einen Referenten für die "Judenfrage" einsetzte (O. v. Harling). Freudenberg drängte die Kirchenkanzlei auch dazu, sich "dem Kernpunkt der ganzen Frage", nämlich der "Entwicklung des christlichen Verständnisses für die Gottesfrage 'Israel'" zu stellen. Der Beauftragte der EKD sah in dem Zusammenschluss der Gesellschaft für Judenmission zum "Ausschuss für den Dienst an Israel" die geeignete Organisation für die Wahrnehmung der anstehenden Aufgabe - zur Entlastung der EKD selbst. Forderungen aus der Ökumene blieben dadurch unwirksam. Nach etlichen Vorstößen Einzelner und nach z. T. heftigen Auseinandersetzungen im Vorfeld hat der Bruderrat der EKD im April 1948 "Ein Wort zur Judenfrage" veröffentlicht. Die Hauptstreitpunkte bildeten die Fragen nach der Judenmission, nach der eigenen Schuld und nach der Wahrnehmung des neuzeitlichen Judentums einschließlich seines Anteils an den gesellschaftlichen Spannungen und an der systematischen Verfolgung und Ermordung. Der erste Teil enthält geschichtliche Hinweise zu den Gründen für das bisherige Schweigen. Darin heißt es u. a.: "Wir sind betrübt über das, was in der Vergangenheit geschah, und darüber, dass wir kein gemeinsames Wort dazu gesagt haben." Deutlichere Worte finden sich im letzten Absatz des zweiten Teils: "Man wollte die Fortdauer der Verheißung über Israel nicht mehr glauben, verkündigen und im Verhalten zu den Juden erweisen. Damit haben wir Christen die Hand geboten zu all dem Unrecht und dem Leid, das unter uns an Israel geschah". Der zweite Teil bietet sechs theologische Aussagen, die abgeleitet werden aus dem grundlegenden Bekenntnis, "dass Jesus von Nazareth ein Jude ist, ein Glied des durch Gottes Erwählung geschaffenen Volkes Israel. Als Gottes ewiges Wort Mensch wurde, hat es Gott gefallen, ihn als den Sohn Abrahams und Davids auf dieser unserer Erde und inmitten dieser unserer Geschichte leben, sterben und auferstehen zu lassen". Dieser christologische Ansatz liegt den folgenden Aussagen über die Verwerfung und Ersetzung Israels durch "die Kirche aus allen Völkern" zugrunde. Zugleich aber wird betont: Wir sind alle an dem Kreuze Christi mitschuldig. Darum ist es der Kirche verwehrt, den Juden als den allein am Kreuze Christi Schuldigen zu brandmarken." Im weiteren ist von Gottes Treue die Rede, die "Israel, auch in seiner Untreue und in seiner Verwerfung nicht loslässt. Christus ist auch für das Volk Israel gekreuzigt und auferstanden. Das ist die Hoffnung für Israel nach Golgatha. Dass Gottes Gericht in der Verwerfung bis heute nachfolgt, ist Zeichen seiner Langmut" Unter den Gerichtsgedanken wird dann auch die jüngste Geschichte gefasst: "Israel unter dem Gericht ist die unauflösbare Bestätigung der Wahrheit, Wirklichkeit des göttlichen Wortes und die stete Warnung Gottes an seine Gemeinde. Dass Gott nicht mit sich spotten lässt, ist die stumme Predigt des jüdischen Schicksals, uns zur Warnung, den Juden zur Mahnung, ob sie sich nicht bekehren möchten zu dem, bei dem allein auch ihr Heil steht." Diese Aussage, die immer noch die Juden und ihre Geschichte für eigene kirchliche Belange instrumentalisiert, hebt theologische Neuansätze wieder auf, die in der Rede von "Gottes Treue" und von der "Fortdauer der Verheißung über Israel" anklingen. Der dritte Teil wendet sich als Aufruf an "unsere Gemeinden und Pfarrer". Darin wird die "geheimnisvolle Verbundenheit zwischen Israel und der Kirche" eingeschärft, vor "allem Antisemitismus" gewarnt und die Mahnung ausgesprochen: "Richtet gegenüber Israel mit besonderer Sorgfalt und mit vermehrtem Eifer das Zeugnis des Glaubens und die Zeichen eurer Liebe auf". Unter dem Eindruck dieses Wortes wurde auf der verfassungsgebenden Kirchenversammlung der EKD 1948 der Antrag gestellt, in den Artikel 16 der Grundordnung folgenden Satz einzufügen: "Die EKD weiß um ihre Schuld und ihre missionarische Verantwortung gegenüber dem Volke Israel". Der Antrag wurde aus theologischen und verfassungsrechtlichen Gründen zurückgezogen. Erleichtert wurde das durch den Vorschlag, "dass dieses Problem auf der ersten ordentlichen Synode der EKD zu behandeln sei und nicht in der Grundordnung aufgenommen werden sollte". Das ist zwei Jahre später auf der EKD-Synode in Weißensee 1950 im Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema "Was kann die Kirche für den Frieden tun?" geschehen. Spontan hatte sich die Überzeugung durchgesetzt, dass "zwischen der dieser Synode gestellten Friedensfrage und der Judenfrage ein tiefer innerer Zusammenhang" bestehe. In der Erklärung sind entscheidende theologische Hemmnisse für die Begründung eines neuen Verhältnisses zum jüdischen Volk entfallen: Die Ersetzungslehre, die Rede von Fluch und Gericht über Israel und der Zusammenhang von heilsgeschichtlichen Aussagen über Israel mit der Judenmission. Die Anstöße sind allerdings von außen gekommen: Einmal war auf der 2. Studientagung des "Deutschen evangelischen Ausschusses für Dienst an Israel" die Aufforderung an die Synode ergangen, "bei ihren Erwägungen zur Frage 'Was kann die Kirche für den Frieden tun?' auch die Judenfrage zu bedenken und dem in ihrer Entschließung Ausdruck zu geben." Zum anderen hatten antisemitische Ausschreitungen wie die Schändung jüdischer Friedhöfe etliche Synodale, nicht zuletzt ihren Präses G. Heinemann, aufgeschreckt. Im Rundfunk hatte Heinemann am 15.4.1950 erstmals den inneren Zusammenhang von unbedingter Absage an alle Judenfeindschaft und einem glaubwürdigen Wort der Kirche zum Frieden ausgesprochen. Auf der Tagung sprachen in ihren einleitenden Beiträgen Visser't Hooft und H. Lilje von der noch immer versäumten Umkehr der Kirche und des deutschen Volkes. Der entscheidende Anstoß aber ging von dem Synodalen Prof. H. Vogel aus. Er hat "den tiefen inneren Zusammenhang zwischen .... Friedensfrage und Judenfrage" herausgestellt. "Es könnte doch wirklich so sein, dass die eigentliche Wurzel des furchtbaren Unfriedens, in dem wir bis heute sind, eben aus unserer Sünde gegen Israel rührt". Daran knüpfte er seinen Vorschlag "mit nackten, dürren Worten gesagt, ein Schuldbekenntnis dieser Generalsynode der EKD an der Schuld unseres Volkes gegenüber Israel ... Die Kirche insbesondere hat ihre Schuld zu bekennen mit dem deutschen Volk an Israel, diese Schuld, in der doch die Wurzel dieses ganzen Übels, dieser grauenhaften Entwicklung liegt". Die Anregung fand allgemeine Zustimmung, von einigen mit Nachdruck; einem Ausschuss unter Federführung von H. Vogel wurde der Auftrag erteilt, ein eigenes Wort in dieser Sache abzufassen und der Synode zur Beschlussfassung vorzulegen. In der Aussprache wurden Bedenken vor allem gegen ein öffentliches Schuldbekenntnis (wegen möglichen politischen Missbrauchs) geäußert, ferner gegen die Rede von der Treue Gottes zu Israel in der Zeitform der Gegenwart und gegen den Verzicht, auch vom Gericht über Israel zu reden. Nach einigen Änderungen, die den Bedenken so weit als möglich Rechnung trugen, ist das Wort am 27. April 1950 einstimmig beschlossen worden.