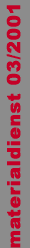Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen
Acht jüdische Gemeinden zwischen Kassel und Darmstadt
von Moritz Neumann
Eigentlich hatte alles ganz anders kommen sollen. Jedenfalls hatte sich 1945 niemand vorstellen können, dass es jemals wieder Jüdische Gemeinden auf deutschem Boden geben würde. Nicht nach der Shoa, diesem gerade von Deutschland aus geführten Vernichtungsfeldzug gegen die Juden Europas. Doch Geschichte geht mitunter ihre eigenen Wege. Und so entstanden, kaum dass die letzten Überlebenden der KZs von den herannahenden alliierten Soldaten gerettet worden waren, Jüdische Gemeinden, wenn auch nur gegründet als Provisorien, als Interessenvertretung auf Zeit. Nicht länger sollten sie existieren als bis zu jenem Datum, da die zufällig zusammengewürfelten und per Schicksal hier gestrandeten jüdischen Menschen ihre Ausreise organisiert haben würden, die Reise in ein Land ihrer Wahl oder wenigstens eines, das sie aufzunehmen bereit war. In Deutschland wollte und würde keiner von ihnen bleiben. Nie und nimmer, komme was da wolle. Dennoch musste bis zum Tag der erhofften Ausreise wenigstens ein Minimum an Lebensqualität geschaffen werden, geistige Lebensqualität vor allem. So waren provisorische Betstuben einzurichten, es war soziale Hilfe für die geretteten Reste des jüdischen Volkes auf deutschem Boden zu leisten, vor allem anderen die Hilfe zur Ausreise. Aus der Übergangslösung entstand vor mittlerweile mehr als fünf Jahrzehnten der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen als eine gefestigte Institution - getreu der Erkenntnis, daß nichts so lange und so stabil überdauert wie eben ein Provisorium. Und daraus sind mittlerweile acht Jüdische Gemeinden zwischen Kassel und Darmstadt geworden. Außer diesen beiden gehören noch Limburg, Fulda, Bad Nauheim, Offenbach, Wiesbaden und Marburg zum Landesverband. Die Aufgaben des Landesverbandes blieben in den rund 50 Jahren weitgehend unverändert, nur die Schwerpunkte wechselten einander ab. Stand während der Anfangsjahre die Versorgung jüdischer Menschen mit den elementaren Bedürfnissen im Vordergrund, mit Wohnraum, Verpflegung und Bekleidung, so konzentrierten sich ein paar Jahre später alle Anstrengungen auf die Integration der Neuankömmlinge, die aus den aufgelösten DP-Lagern, etwa Zeilsheim bei Frankfurt/M. oder Lampertheim an der Bergstraße, auf die Städte verteilt wurden. Wobei nicht zu vergessen ist, daß all diese Arbeit größtenteils überhaupt nur dadurch geleistet werden konnte, daß die jüdisch-amerikanische Hilfsorganisation IRSO den Gemeinden zur Seite stand und sie mit allem versorgte, was gebraucht wurde. Und immer noch geschah all dies in der eigenen Überzeugung, nur eine Bleibe auf Zeit zu organisieren. In den sechziger Jahren war der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen zum funktionierenden Bindeglied zwischen den Jüdischen Gemeinden im Lande geworden, deren Zahl und Mitgliederstärke zwar deutlich zurückgegangen war, eben reduziert auf den offenbar unvermeidlichen Bodensatz nach der Auswanderung der Mehrheit, deren Mitglieder aber trotz ihrer nur noch geringen Zahl Erwartungen und Bedürfnisse hatten, die es zu regeln galt. Da war das Gebiet der religiösen Sorge, da war die Sicherstellung von Religionsunterricht mit Wanderlehrern, die selbst dann noch auf den Weg geschickt wurden, wenn in einer Gemeinde nicht mehr als drei jüdische Kinder zu unterrichten waren, da war die soziale Betreuung - stets mit dem Schwergewicht einer Vermittlung oder Wahrung von Traditionen, die üblicherweise das jüdische Leben bestimmen und die doch unter den herrschenden Bedingungen nur äußerst schwierig einzuhalten waren. Anders sah die Situation in der Stadt Frankfurt/M. aus, einer Jüdischen Gemeinde von einigen tausend Mitgliedern und damit mehr als doppelt soviel wie in allen anderen Jüdischen Gemeinden im Lande Hessen zusammen. Für Frankfurt/M. waren Hilfen der Stadt und des Landes leichter durchzusetzen als für eine Ansammlung von Klein- und Kleinstgemeinden mit vielleicht nicht mehr als 50 oder 60 Mitgliedern. Es gab mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter, es gab erheblich bessere Möglichkeiten zur Ausübung religiösen Lebens und zur Wahrung der vorgeschriebenen Religionsgesetze. Den verstreuten jüdischen Menschen in Wiesbaden und in Offenbach, in Marburg und in Fulda konnte dies freilich kein Trost sein, denn sie brauchten die Betreuung und Versorgung vor Ort in ihrer unmittelbaren Nähe. Doch Betreuung kostet Geld und der Landesverband war nicht mit irdischen Gütern gesegnet. So blieben Anstrengungen zur Selbsthilfe, die stets von hohem ehrenamtlichen Engagement ausgezeichnet waren, viel zu oft in Bodennähe stecken und damit auch die Ideen, wie man es besser machen könnte. Die jüdische Realität in Hessen der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre war stets gekennzeichnet von zu geringer Finanzkraft und dem Zwang zur Bittstellerei bei Land und Kommunen. Die nachhaltigste Veränderung im zahlenmäßig sehr bescheidenen jüdischen Leben in Deutschland kam schließlich mit dem Niedergang des Eisernen Vorhangs. Der Fall der Berliner Mauer, die plötzlichen Freiheiten der jahrzehntelang drastisch eingeschränkten Menschen im Osten Europas setzte einen Aufbruch in Gang, der vornehmlich russischen und ukrainischen Juden die Ausreise und die Auswanderung nach Israel, in die USA und nach Deutschland ermöglichte. Seither haben auch die Jüdischen Gemeinden in Hessen eine zahlenmäßige Verstärkung erfahren, einen Vitalisierungsschub, der die Mitgliederzahlen erheblich in die Höhe getrieben hat, auf inzwischen fast 4000. Um es mit einem Satz von Ignatz Bubis, dem verstorbenen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, zu sagen: "Wir haben uns nahezu verdreifacht. Aber unsere Probleme haben sich mindestens versechsfacht." Der Kreis schließt sich. Noch immer fehlen ausreichende Mittel, noch immer und wieder müssen jüdische Repräsentanten die Klinken von Landesregierung und Magistraten putzen. Noch immer haben Politik und Verwaltung viel (verbales!) Verständnis für die alltäglichen Probleme, die sich nun in Folge der Zuwanderung aus der einstigen Sowjetunion merklich verstärkt haben - und noch immer wird von verbalem Verständnis allein niemand satt. Nicht zu vergessen ist allerdings die immer wieder seitens der Hessischen Landesregierung geleistete Hilfe beim Bau von Synagogen und Gemeindezentren, ebenso die Unterstützung, wie sie von immerhin einigen Kommunen ermöglicht wurde, um die einmal entstandenen Synagogen überhaupt unterhalten zu können. Beispiele anhaltender und spürbarer Hilfe gibt es in den Städten Frankfurt und Darmstadt, Synagogen-Neubauten entstanden zudem gerade in den zurückliegenden Jahren in Offenbach und Kassel. Daß die öffentliche Hand immer wieder G"tteshäuser zu bauen half, ist andererseits so abwegig nicht. Schließlich waren es in gewisser Weise auch öffentliche Hände, pervertierte öffentlicher Hände, die in der Schandnacht vom 9. November 1938 die Synagogen in Deutschland in Schutt und Asche gelegt hatten. Ohne schlechte Beispiele freilich scheint es nicht abzugehen: Vor anderthalb Jahren gründete der Landesverband die vorerst jüngste Jüdische Gemeinde Hessens in Limburg. Auf die erste Handreichung der dortigen Stadt-Politiker allerdings wartet man noch heute. Nicht einmal eine bescheidene Unterkunftsmöglichkeit wurde bislang gefunden. Es könnte kaum deutlicher zu spüren sein, wie sehr das jüdische Gemeindeleben hierzulande noch längst nicht normal ist. Moritz Neumann ist Vorsitzender des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen