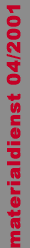Informationen aus Israel
von Michael Krupp und Ulrich Sahm, Jerusalem
- Talita Kumi feiert 150 Jahre
- Fruchtbarkeitsgott - antike Synagoge - antike Gräber
- Hohepriester der Samaritaner gestorben
- Alexander Brenner erwartet "aufreibende Aufgabe"
- Israel kritisiert den Papst
- Dirigent Barenboim brach israelisches Wagner-Tabu
- Landkarte fürs Überleben
Talita Kumi feiert 150 Jahre
Mit der Palästinensischen Nationalhymne, Biladi, Mein Heimatland, wurden die Feierlichkeiten zum 150jährigen Bestehen des Internats Talita Kumi eingeleitet. So zu werden, dass die Mutter Palästina auf sie stolz sein könne, forderte der Bürgermeister des Westbankstädchens Beit Jalla, in dem das Internat liegt, die Schülerinnen und Schüler auf. Ein Vertreter des palästinensischen Erziehungsministeriums lobte die Deutschen für ihre Erziehungsarbeit in Palästina. Der lutherische Bischof, Munib Jounan, hob die Erziehung zum Zusammenleben von christlichen und moslemischen SchülerInnen hervor, frei von Proselytismus und Mission, keineswegs eine Selbstverständlichkeit an den christlichen Schulen im Nahen Osten, eingeschlossen der deutschen. Der Vertreter des Berliner Missionswerkes, des Trägers der Schule, Professor Reihlen, erinnerte an das alte Wort vom Arabia felix, dem glückliche Arabien, das es wiederzuentdecken gäbe, auch in diesen schlimmen Zeiten. Alles in allem ein erfreuliches Ereignis in der leidgeprüften Region Beit Jalla, in dem es fast täglich zu Schießereien mit dem benachbarten jüdischen Wohnviertel von Jerusalem, Gilo, kommt. Auch das Schulgelände selbst, genau auf der Grenze zwischen Zone A und C, der palästinensischen und israelischen Verwaltung, war Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Freischärlern, die nicht Zöglinge des Internats sind. "Wir haben einen Waffenstillstand für drei Tage", sagte scherzend und halbernst der Leiter des Internats, Wilhelm Goller. Von Freitag bis Sonntag dauerten die Feierlichkeiten, zu dem eine Reihe von Gästen auch aus Deutschland angereist waren. Unter anderen auch ein Vertreter der Diakonissenanstalt Kaiserswerth, die vor 150 Jahren das Internat gegründet hatte. Damals, 1851, war es ein Waisenhaus für Mädchen gewesen, später eine Mädchenschule und ein Internat. Der Name "Talita Kumi" entstammt dem Neuen Testament und ist das aramäische Wort, das Jesus zu dem Töchterlein des Jairus spricht: "Mädchen steh auf!" Das ursprüngliche Haus lag außerhalb Jerusalems im Westen der Stadt, das bald zum Zentrum des jüdischen Jerusalems werden sollte und nach 1948 für die arabischen Mädchen nicht mehr zugänglich war. Deswegen verließ die Schule Israel und wechselte ins damalige Jordanien über und fand eine neue Heimat auf dem höchsten Berg von Beit Jalla neben Bethlehem. Kaiserswerth gab die Trägerschaft 1975 an das Berliner Missionswerk ab, das auch noch andere Schulen in der Westbank unterhält mit über 2000 Schülern, wahrscheinlich mehr als die kleine arabisch-lutherische Gemeinde Mitglieder hat.Michael Krupp
Fruchtbarkeitsgott - antike Synagoge - antike Gräber
Beim Bau der Trans-Israel Schnellstraße ist ein 6000 Jahre altes Grab aus chalkolithischer Zeit entdeckt worden. Das Besondere an dem Fund sind die aufgefundenen Beigaben. Darunter befindet sich eine kleine Tonfigur, die einen männlichen Fruchtbarkeitsgott darstellt. Der rechte Arm der Figur ist abgebrochen. Die Archäologen vermuten, dass er das versteifte Glied des Gottes gehalten hat. Eine solche Darstellung gilt als einmalig für diese Gegend. Im kanaanitischen Fruchtbarkeits-Kult wurden meist Astarte-Figuren, die Abbildung einer hochschwangeren Frau, verehrt. Vielleicht handelt es sich bei der aufgefundenen Statue um eine frühe Abbildung des Baal-Gottes, der gewöhnlicherweise als Stier dargestellt wird. In Modiin wurde bei Arbeiten zur Erweiterung einer Straße eine Synagoge aus der Zeit vor der Tempelzerstörung gefunden. Die Synagoge stammt aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert und wurde im Bar Kochba Aufstand (133-135 n.Chr.) zerstört. Die Synagoge hat einen ähnlichen Aufriss wie andere aus der Zeit vor der Tempelzerstörung gefundene antike Synagogen, Sitzreihen an allen vier Wänden. Spätere Synagogen haben an der nach Jerusalem zugewandten Seite keine Sitzreihe. Unter den gefundenen Gegenständen ist ein größeres Steingefäß, was wahrscheinlich zu rituellen Waschungen benutzt wurde. Dies entspricht den pharisäischen Vorschriften, solche Gefäße aus Stein herzustellen, da sie gegen Unreinheit unempfindlich sind. Außerdem wurden zwei Inschriften gefunden, eine in Griechisch, die noch nicht entziffert wurde. Über den Inhalt der hebräischen Inschrift wurde nichts bekannt. Außerdem fanden sich Darstellungen von Weintrauben wie häufig in antiken Synagogen. Modiin ist die Heimatstadt der Hasmonäer oder Makkabäer, die im zweiten vorchristlichen Jahrhundert die Unabhängigkeit gegen die Griechen erkämpft haben. Der Synagogenfund ist ein weiterer Beleg dafür, dass es neben dem Tempel die Einrichtung von Synagogen gab, wie es auch im Neuen Testament bezeugt ist. Außer dem neuen Fund gibt es Synagogen aus der Zeit vor der Tempelzerstörung in Massada in der Wüste Juda, auf dem Herodion bei Jerusalem und in Gamla auf dem Golan. Ein neuer "Religionskrieg" ist in Tiberias ausgebrochen. Arbeiten an einem 20 Millionen Dollar Projekt der schottischen Kirche, das ein Hotel, die Restaurierung eines Hostels und eine Kirche umfasst, sind inzwischen von der Stadtverwaltung gestoppt worden. Das Bauprojekt im Herzen der Stadt Tiberias am See Genezareth soll sich auf einem Gräberfeld befinden, wobei unklar ist, aus welcher Zeit die Gräber sind und wer hier begraben ist. Die jüdische Orthodoxie behauptet, es handele sich um jüdische Gräber und ist auch nicht bereit, archäologische Ausgrabungen zuzulassen. Orthodoxe Kreise haben zu Massendemonstrationen aufgerufen, falls die Bauarbeiten fortgesetzt werden sollten und haben die Beteiligung an diesen Demonstrationen als "heilige Pflicht" erklärt. Die schottische Kirche hat bisher 6 Millionen Dollar in das Projekt gesteckt und 500.000 Dollar für archäologische Ausgrabungen, die das Gesetz vorschreibt, zur Verfügung gestellt. Jetzt soll das Oberste Gericht über das weitere Schicksal des Projekts entscheiden.Michael Krupp
Der Hohepriester der Samaritaner gestorben
Der Hohepriester der Samaritaner, Levi Ben-Avishai Ben Pinhas, ist Ende Mai gestorben und auf dem heiligen Berg der Samaritaner, dem Garizim, beigesetzt worden. Das Oberhaupt der kleinen Gemeinde der Samaritaner war 83 Jahre alt und starb an Altersschwäche. In einer in diesen Tagen selten zu sehenden Einmütigkeit begruben ihn Angehörige der Samaritaner zusammen mit palästinensischen und israelischen Würdenträgern und Militärs. Der Berg Garizim, die Wohnstatt der Samaritaner im palästinensischen Gebiet, liegt in der Zone B, dem Gebiet unter palästinensischer Zivilverwaltung und unter israelischer Militärkontrolle. Nachfolger im Amt des Hohenpriesters der 600 Seelen starken Gemeinschaft wurde der 79jährige Jefet Shomroni, der zugleich samaritanischer Vertreter im palästinensischen Parlament ist. Es ist noch unentschieden, ob er dieses Amt auch in Zukunft beibehalten wird. Die ca. 600 Samaritaner sind das Überbleibsel des einst großen Volkes der Samaritaner, die in der christlichen Welt besonders durch das Gleichnis Jesu vom Barmherzigen Samaritaner bekannt sind. Die im Alten wie Neuen Testament häufig erwähnten Samaritaner sind das Brudervolk der Juden, ein Mischvolk aus Israeliten und Fremdvölkern, die nach der Wegführung des Nordreiches Israel in Samarien angesiedelt wurden. Die Samaritaner haben noch viele alttestamentliche Gebräuche beibehalten, so das Passaopfer, das auf dem Berg Garizim geschlachtet wird. Heute leben noch ca. 300 Samaritaner in Nablus und dem benachbarten Berg Garizim, auf dem der Tempel der Samaritaner stand, und ca. 300 im israelischen Holon, südöstlich von Tel Aviv. Für die arabische Bevölkerung in Nablus gelten die Samaritaner als Juden.Michael Krupp
Alexander Brenner erwartet "aufreibende Aufgabe"
"Die Gegensätze innerhalb der jüdischen Gemeinde zu glätten wird für sicherlich aufreibender sein als das Wirken nach Außen", sagt der neugewählte Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Berlins, Alexander Brenner in einem telefonischen Interview. "Besorgt machen mich die schrecklichen Verdrehungen in der Presse, vor allem bei der Berichterstattung über Israel", sagt Brenner weiter, der fließend Hebräisch spricht, regelmäßig seine bei Tel Aviv lebende Schwester besucht und als Wissenschaftsattache an der deutschen Botschaft in Tel Aviv gedient hat. Brenner erboste sich ganz aktuell über einen Kommentar in der ARD. Aus Verantwortung für den Holocaust, so der Kommentar, sei es nun die Aufgabe Deutschlands, sich an die Spitze von Ländern zu stellen, die Israel mit Sanktionen bestrafen sollten. "Wo kommen wir hin, wenn der Holocaust nun schon als Argument verwendet wird, erneut die Juden zu boykottieren. So begann doch alles nach der Machtergreifung Hitlers." Brenner stammt aus einer polnischen Kleinstadt (Stetl) nahe der Grenze zur Ukraine. Den Zweiten Weltkrieg überlebte er mit seinen Eltern in der Deportation in Sibirien. Nach dem Krieg schlug er sich über Polen nach Berlin durch, wo er als Chemiker promovierte. Brenner schloss sich dem diplomatischen Dienst an. In den siebziger Jahren, in der Breschnew-Epoche diente er als Wissenschaftsattache an der deutschen Botschaft unter Botschafter Dr. Ulrich Sahm. In dieser Zeit kamen Brenner die vielseitigen Sprachkenntnisse zu Gute. Neben seinen Muttersprachen Polnisch, Hebräisch, Jiddisch und Deutsch beherrscht er auch Englisch. In Moskau knüpfte er halblegal enge Beziehungen mit den Juden in der großen Synagoge in der Archipowa-Straße. Bei den russischen Künstlern der Boheme, die trotz des sowjetischen Regimes ihre Selbstständigkeit bewahrten, verkehrte er "wie ihresgleichen" und nicht in der Funktion eines deutschen Diplomaten. Trotz der allgegenwärtigen Agenten des KGB und der in jeder Datscha vorhandenen Mikrophone des Geheimdienstes konnte Brenner zum Teil sehr namhaften sowjetischen Künstlern helfen, mit dem Diplomatenkurier die persönlichen Unterlagen etwa des Cellisten Rastropowitsch in den Westen zu schmuggeln oder den Balletkünstlern Pawlow die Ausreise zu ermöglichen. Deutschland und Israel arbeiteten damals eng zusammen, denn ein Kuriosum der Geschichte hatte dazu geführt, dass allein Deutsche aus den Wolgagebieten und Juden das Recht hatten, die Sowjetunion halbwegs legal zu verlassen. Diese humanitäre Zusammenarbeit war streng geheim und Brenner war einer der Drahtzieher dank seiner persönlichen Kontakte zu den Russen, der Bundesrepublik und Israel. Nach einem Aufenthalt in Israel, ebenfalls als Wissenschaftsattache, schloss Brenner sich der Europäischen Kommission an, mit der Aufgabe, den Russen bei der Abrüstung und der Entsorgung ihrer Atomindustrie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu helfen. Unter anderem bemühte sich Brenner darum, das Schicksal der russischen Atomwissenschaftler zu erleichtern, damit sie nicht in problematische Staaten wie Iran oder Irak abgeworben werden könnten. In der Presse wurde Brenner als "orthodoxer Jude" dargestellt. "Ja ich war öfters mal in der Synagoge", sagt Brenner lachend. Er gehört durchaus zur "orthodoxen" Richtung des Judentums, betrachtet sich selber als "weltlicher" Mensch. Vor allem aber fühlt er sich der jüdischen Kultur im weitesten Sinne verbunden. Die Religion ist dabei ein Element, das allerdings den jungen nach Deutschland eingewanderten russischen Juden erst beigebracht werden müsse. In der Sowjetunion wurden sie als "Hebräer" bezeichnet und standen so am Rande der Gesellschaft. Zu ihrer eigenen Identitätsfindung sei es heute in Deutschland wichtig, diesen Begriff nach 70 Jahren kommunistisch-atheistischer Herrschaft wieder mit Inhalten zu füllen.Ulrich W. Sahm
Israel kritisiert den Papst
Im israelischen Kabinett wurde am Sonntag Morgen Kritik am Papst laut. Bei der Begrüßung des Papstes auf dem Flughafen von Damaskus hatte Syriens Präsident Baschar Assad eine präzedenzlos scharfe Attacke auf "die Juden" geäußert, ohne den Staat Israel beim Namen zu nennen. Jene "Verbrecher" so Assad, würden heute die Palästinenser "morden und foltern", so wie sie damals Jesus "verraten" und versucht hätten, den Propheten Mohammed zu töten. Assad warf den Juden vor, Heilige Stätten des Islam und auch des Christentums zu entweihen. Assad erwähnte ausdrücklich die Grabeskirche in Jerusalem und die Geburtskirche in Bethlehem, obgleich die schon seit fünf Jahren unter palästinensischer Kontrolle steht. Assad fuhr fort und forderte indirekt eine Auflösung des Staates Israel, indem er den Papst aufforderte, zu helfen "Palästina wieder seinen ursprünglichen Besitzern, den Arabern, zurückzugeben". Der Papst verlas seine schon im Voraus formulierte Rede und ging so auch nicht auf Assads "Gottesmord-Theorie" ein, die längst aus der Lehre der katholischen Kirche gestrichen worden ist. Im Rahmen der Kritik an dem Papst wurde an den Zwischenfall mit Hillary Clinton erinnert, die geschwiegen hatte, als in ihrem Beisein Suha Arafat, die Gattin des Palästinenserpräsidenten behauptet hatte, dass die Israelis "palästinensische Kinder mit Giftgas umbringen". Israels Staatspräsident warf am Mittag dem syrischen Präsidenten "ungezügelte antisemitische Äußerungen" vor, erwähnte aber nicht den Papst, in dessen Anwesenheit die Äußerungen gemacht wurden. Präsident Katzav meinte, dass Assad noch jung sei und ein wenig Weltgeschichte wie die Geschichte des jüdischen Volkes studieren sollte, "um nicht wieder so schreckliche Fehler zu machen". Derweil hat das israelische Außenministerium eine offizielle Erklärung an die Presse gegeben. Wörtlich heißt es da: "Der Besuch des Papstes in Syrien wurde dargestellt als eine Pilgerfahrt auf den Spuren von St. Paulus, vergleichbar mit der Reise nach Israel im vergangenen Jahr. Bedauerlicherweise wurde schon zu Beginn der Reise klar, dass sie vom syrischen Präsidenten ausgenützt wird als Plattform für eine antijüdische Kampagne, indem antisemitische Beschuldigungen geäußert wurden, die im Laufe der Zeiten zu viel Blutvergießen geführt haben. Der Heilige Stuhl und die aufgeklärte Welt haben schon vor Jahrzehnten diese religiöse und rassistische Hetze verworfen. Wir hoffen, dass Seine Heiligkeit eine passende Gelegenheit finden wird, noch im Laufe seines Besuches in Syrien, seine Ablehnung dieser hasserfüllten Verleumdungen zu äußern. Es ist fast überflüssig festzustellen, dass diese Worte des syrischen Präsidenten kein Beitrag für die Botschaft von Vertrauen, gegenseitiger Achtung und guten Willens sind, die der Papst hoffte, dieser Region bringen zu können."Ulrich W. Sahm
Dirigent Barenboim brach israelisches Wagner-Tabu
"Ich habe eine ganz private Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen, etwas ganz persönliches nur zwischen Ihnen und mir", sagte der Dirigent Daniel Barenboim auf Hebräisch zu den dreitausend Konzertbesuchern in der "Halle der Nationen" in Jerusalem. "Ich möchte Wagner spielen", erklärte Barenboim, nachdem er Schumann und Strawinsky entsprechend dem Programm dirigiert hatte und Tschaikowskys Blumenwalzer als Zugabe abgeliefert hatte. In dem großen Saal erklangen erste Buh-Rufe und Applaus. "Ich möchte keine Gefühle verletzen. Ich verstehe, dass einige Menschen unfähig sind, Wagner zu hören. Die bitte ich jetzt den Saal zu verlassen." Aus dem Publikum kamen brausender Applaus und laute Protestrufe. "Diese Halle gehört der Jewish Agency. Sie haben kein Recht, hier in einem Saal, der Eigentum des Staates Israels ist, die Musik dieses Nazi aufzuführen. Das ist hier kein privater Saal." Ein anderer brüllte: "Ich habe hunderte Schekel für das Ticket bezahlt, aber nicht um Wagner zu hören." Geduldig forderte Barenboim diesen Mann auf, nach dem Konzert zu ihm zu kommen. Er werde ihm den kompletten Eintrittspreis erstatten. "Ich habe hier auf ein Honorar verzichtete, weil dies mein Land ist", erklärte Barenboim, als ein Mann mit einem Schlüsselbund in der Hand auf die Bühne sprang und Barenboim aufforderte, auf diese "Provokation" zu verzichten. Auf seinem Schlüsselanhänger war freilich ein Mercedesstern eingraviert. Einige Zwischenrufer verließen unter Protest den Saal, andere gingen schweigend. Stille legte sich über das Publikum, als Barenboim schließlich zum Dirigentenpult zurückkehrte und dem Publikum den Rücken zukehrte. Bullige Sicherheitsleute mit Skinheadglatzen begaben sich in Position, um den in Argentinien gebürtigen jüdischen Dirigenten der Berliner Staatskapelle vor Übergriffen zu schützen. Kaum erklangen die ersten Takte der Ouvertüre von Tristan und Isolde, da klapperten lautstark die Türen des Festssaals. Barenboim ließ sich nicht irritieren. Ein Mann schrie kurz, aber das Konzert ging weiter. Mit rauschendem Applaus endete der historische Abend. "Wieso bist Du denn nicht rechtzeitig rausgegangen, wenn Du das nicht aushälst", fragte ein französischer Jude seine verstörte Frau. Die blieb eine Antwort schuldig. Eine Professorin für Folkloristik, die auch deutsches Theater lehrt, wußte vom Intellekt her, dass sie Wagner nicht boykottieren dürfe. Unter Schmerzen hörte sie sich das Stück an. Doch als andere klatschten, brach aus ihr ein emotionales "Buh" heraus. Die jungen Musiker der Berliner Staatskapelle, die meisten von ihnen aus Ostdeutschland, waren zum ersten Mal in Israel. Sie waren sehr neugierig und hatten viel Mitgefühl für die "historische Situation", in die sie unfreiwillig geraten waren. "Hoffentlich hat niemand mein Herzklopfen gehört", sagte Matthias Clander, Klarinette. Egbert Schimmelphennig vom Orchestervorstand meinte: "Wir hatten Lampenfieder, wie beim ersten öffentlichen Auftritt." Carola Höhn, Opern- und Konzertsängerin, hatte Tränen in den Augen und meinte: "Noch nie habe ich ein solches Konzert mit soviel Spannungen erlebt." Schon vor Monaten hatte in Israel die Diskussion um Wagners Walküre begonnen, als die Leitung des Israel Festivals ihr Programm veröffentlichte. Vor allem rechtsgerichtete Israelis hoben Wagners notorischen Antisemitismus hervor und wiesen auf Hitlers Vorliebe für Wagner hin. Es wurde behauptet, dass jüdische Opfer der Nazis auf dem Weg zu den Gaskammern den Klängen Wagners lauschen mussten, gespielt von jüdischen KZ-Orchestern. Überlebende des Holocaust widersprachen und meinten dass sie in Sachsenhausen, Auschwitz und Mauthausen alles spielen durften außer Wagner. Der Druck auf die Festivalleitung wuchs, während die internationalen Nachrichtenagenturen den Streit in alle Welt berichteten. Erst bestand Barenboim darauf, Wagner zu spielen. Schon drei Tage nach der Veröffentlichung des Programmes war sein Konzert ausverkauft. Fast 5000 Israelis sicherten sich Karten zum Preis von je 200 Mark. Doch schließlich gab Barenboim nach und stimmte einer Streichung der Walküre aus dem Programm zu. Ein Drittel der potenziellen Konzertbesucher stornierten ihre Kartenbestellungen und verlangten ihr Geld zurück. Aber Barenboim ließ nicht locker. Trotz der Absage der Festivalleitung plante er gewissenhaft den Auftritt. "Nur für das Wagnerstück ließ er auch zwei Harfen einfliegen", erzählte ein Orchestermitglied, das die nächtelangen Diskussionen mit Barenboim miterlebt hatte. In Jerusalem eingetroffen, war der Plan Barenboims ein streng gehütetes Geheimnis. Der 90 Jahre alte Ex-Bürgermeister Teddy Kollek fragte den Maestro bei einem Empfang der Jerusalem-Stiftung: "Sag mal, warum läßt Du dich kleinkriegen. Warum spielst Du nicht Wagner. Es ist an der Zeit." Barenboim nahm sich die Aufforderung zu Herzen. Die internen Diskussionen gingen weiter. Am Samstag Mittag war schon der Kulturattaché der deutschen Botschaft informiert und auch die Musiker. "Wir hatten die Noten parat, gleichgültig ob es zustande kommt oder nicht." Nach dem Konzert begleiteten Sicherheitsleute den Maestro zum benachbarten Hotel. Barenboim wurde von einigen Musikern umarmt. "Ich muss Euch danken, dass ihr mitgespielt habt und den Mut hattet" meinte er bescheiden und griff zum Handy. "Ihr Angsthasen, ihr habt Euch einfach aus dem Staube gemacht, obgleich ich doch dem Publikum ausdrücklich erklärt habe, dass die Festivalleitung und das deutsche Orchester unschuldig seien. Ich habe alle Verantwortung allein auf mich genommen", beschimpfte er ein Mitglied der Festival-Leitung. Eine Israeli saß in der Runde und attackierte Barenboim auf Hebräisch: "Das war eine unfaire Provokation, hier die Israelis vor vollendete Tatsachen zu stellen..." Barenboim ließ sich nicht aus der Fassung bringen. "Hör mal gut zu. Der Wagner rotiert dreißig Mal im Grabe, sowie er erfährt, dass diese verdammten Juden ihn trotzdem in Jerusalem aufgeführt haben. Wir Juden sollten den Nazis nicht im Nachhinein einen Sieg gönnen, indem wir Wagner boykottieren, nur weil Hitler Wagner mochte." Antisemiten habe es viele unter den Komponisten gegeben. Die Musikgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts sei unverständlich ohne Wagner, und ohne Wagner hätte es weder Mahler noch Schönberg geben können, "übrigens beides Juden". Mitten in der Nacht, wenige Stunden vor seinem Rückflug nach Berlin, stellte sich Barenboim einem Interview im israelischen Rundfunk. "Ich habe nur wirklich ein Tabu gebrochen, wenn jetzt auch die Jerusalemer Symphoniker es wagen, Wagner aufzuführen. Wenn nicht, dann wird meine Initiative eine Episode bleiben." Nach dem Konzert riefen jüdische Organisationen in Israel und in der Welt zu einem Boykott Barenboims auf. Jossi Talgan, Direktor des düpierten "Israel Festival Jerusalem" in dessen Rahmen Barenboim in Jerusalem sein letztes Konzert gab, meinte: "Es wird Barenboim nicht sonderlich stören, wenn er von uns nicht mehr eingeladen wird." Die Festivalleitung habe schon drei Tage vor dem Überraschungscoup einen Hinweis aus dem Orchester erhalten. So war aufgefallen, dass auch zwei Harfen im Reisegepäck des Orchesters waren, die aber nicht gebraucht würden, wenn sich Barenboim an das abgesproche Programm gehalten hätte. Ebenso hätten die Israelis unter den Notenstapeln auch Wagner gesehen. "Wir hatten mit Barenboim vor dem Konzert gesprochen, aber er hat sein Wort nicht gehalten. Das war reiner Betrug und Wortbruch. Das wird nur ihm schaden", sagte Talgan gegenüber der Zeitung Jedijot Achronot. Staatspräsident Mosche Katzav beschuldigte Barenboim eines "unlauteren Überholungsmanövers" während Ministerpräsident Scharon behauptete, dass es wohl immer noch zu früh für Wagner in Israel sei. "Das hätte nicht passieren dürfen. Es leben unter uns immer noch viele Menschen, die Wagner nicht hören können, wegen der Vergangenheit.". Kulturminister Matan Vilnai sprach von einem "Kidnapping" und einer "kulturellen Vergewaltigung". Es habe ausdrückliche Absprachen gegeben, die Barenboim ignoriert habe. Das sei sehr bedauerlich. Gefühle in der israelischen Bevölkerung seien verletzt worden. "Hoffentlich zieht die Festival-Leitung eine Lehre aus dem Vorfall." Jerusalem Bürgermeister Ehud Olmert war "wütend" über Barenboims "Chutzpe". Barenboim mag Olmert nicht und weigerte sich bei einer Begegnung, ihm die Hand zu drücken, während er mit Olmerts Vorgänger Teddy Kollek eng befreundet ist. Während Kollek vor dem Konzert aufgefordert hatte, doch trotz der Widerstände Wagner zu spielen, sagte Olmert nach dem Auftritt: "Kein Zweifel, Barenboim ist ein großer Musiker aber er ist ein kleiner Mensch." Der fromme Abgeordnete Schaul Jahalom, ein führender Gegner von Wagneraufführungen, meinte, dass Barenboim "die Erinnerung an den Holocaust verunglimpft" habe und dass er dem israelischen Volk "mit großer Unverschämtheit eine schallende Ohrfeige erteilt" habe. Staatliche Einrichtungen, darunter die Knesset, hätten mit einem demokratischen Mehrheitsbeschluss gegen Wagner gestimmt und Barenboim habe gegen demokratische Beschlüsse verstoßen. "Mit Gewalt und Egoismus" habe Barenboim seinen Willen den Israelis aufgewungen. Ein 67 Jahre alter Holocaustüberlebender hat bei der Polizei eine Beschwerde gegen Barenboim wegen "öffentlicher Gefühlsverletzung" eingereicht. Der Direktor des Simon Wiesental-Zentrums in Israel, Efraim Zuoff fordert wegen dieser "Vergewaltigung" alle israelische Orchester auf, Barenboim künftig die Zusammenarbeit zu verweigern. Der israelische Militärsender Galei Zahal berichtete auch von Empörung und Boykottaufrufen jüdischer Organisationen in den USA. In den israelischen Zeitungen gab es keine einzige Stimme, die Barenboims Schritt rechtfertigte oder begrüßte. Es ist nicht üblich, dass ein Korrespondent sich selber auf die Schulter klopft, doch da ich an dem inzwischen weltweiten Barenboim-Skandel aus mehreren Gründen nicht ganz unbeteiligt war, schreibe ich hier noch meine eigene Story und wie es dazu kam. Eine Berliner Zeitung gab einen Routineauftrag durch. Ob vielleicht ein Fotograf die Kultursenatorin Adrienne Goehler, den Dirigenten Daniel Barenboim und die Berliner Staatskapelle bei ihrem Besuch in der Holocaustgedenkstätte Yad Vaschem und ins Israel-Museum begleiten könne. In der sommerlichen Hitze sind solche Aufträge eher anstrengend. Meine Frau machte die fotografische Arbeit, während wir als "Taschenträger" der Fotografin mitliefen. Auf dem Weg zur Kranzniederlegung in Yad Vaschem "klingelte" unser Handy. Eher zufällig und gewiss nicht aus böser Absicht hatten wir die Melodie von Wagners Walkyre ausgewählt. Wir dachten, dass wir so das eigene Handy besser vom Klingeln anderer israelischer Handys unterscheiden könnten. Daniel Barenboim zuckte erschreckt zusammen, als er die doch sonst eher störende Melodie hörte, lachte dann aber. "Also darf man offenbar in Israel doch Wagner spielen." Dieser kleine Zwischenfall in Yad Vaschem passierte am Freitag, nach monatelangen Diskussionen über die von Barenboim ursprüngliche geplante Wagner-Aufführung, die dann nach Debatten in der Knesset, Klagen beim Obersten Gericht und schließlich durch einen Beschluss der Festivalleitung abgesetzt worden war. Am Samstag Nachmittag kamen einige Musikanten und Mitglieder des Orchestervorstandes, um auf unserer Terrasse etwas über die politische Lage in Israel zu hören. Als das Taxi schon vor der Tür stand, um sie zurück zu Konzertsaal zu bringen, meinte einer von Ihnen: "Herr Sahm, wollen Sie übrigens Freikarten für das Konzert haben? Es könnte für sie ganz interessant werden." Wir fragten erstaunt: "Wieso?" Der Herr von Berlins Staatskapelle meinte nur: "Es könnte sein, dass Barenboim doch Wagner spielt. Die Noten haben wir mitgebracht und sogar zwei Harfen haben wir nur zu diesem Zweck nach Israel eingeflogen." Das war ein brisantes Angebot, doch ahnten wir nicht, der einzige Journalist zu sein, dem das schon vorher verraten worden war. Wir versprachen natürlich, nichts darüber im Voraus zu veröffentlichen. Aus Kollegialität, damit das historische Ereignis dokumentiert werde, riefen wir den ersten Kanal des israelischen Fernsehens an. Der verantwortliche Redakteur sagte: "Danke für den Hinweis, weil es aber Samstag ist, haben wir kein freies Team." Beim Zweiten Kanal des israelischen Fernsehens reagierten die Kollegen schon mit größerem Interesse. Erst später erfuhren wir, dass die bei der Festivalleitung anriefen, um eine Drehgenehmigung zu erhalten. Die wurde ihnen strikt verweigert. Nach einer Stunde riefen die Kollegen an und fragten, ob wir etwas dagegen hätten, eine Amateurkamera ins Konzert mitzunehmen. "Aber ich habe doch noch nie eine Videokamera in der Hand gehalten." Die Kollegen meinten: "Dann wollen wir hoffen, dass es gut geht." Wenig später hupte ein Taxi vor der Haustür und übergab die Kamera des Polizeireporters. Wie denn der geplante Ablauf sei, fragten wir hinter den Kulissen noch ein Vorstandsmitglied der Staatskapelle, doch der sagte mit verschlossenen Lippen und ohne zu schmunzeln: "Das können Sie doch dem Programm entnehmen." Wir wußten, dass Barenboim die Entscheidung bis zuletzt offen lassen wollte. Er wolle erst einmal die Stimmung im Saal prüfen und Wagner, wenn überhaupt, nur als zweite Zugabe spielen, hatte man uns am Nachmittag gesagt. Als Barenboim auf der Bühne stand und dem Publikum sein überraschendes Angebot machte, argumentierte er auch mit der Wagnermelodie unseres Handy. Als die Tumulte im Konzertsaal ausbrachen, schaute Barenboim in unsere Richtung, wie um sich zu vergewissern, dass wir das alles dokumentieren. Ein bulliger Sicherheitsmann stürzte sich auf uns. Es sei verboten zu Filmen. "Aber wir sind doch vom Orchester und filmen in deren Auftrag", logen wir. Später, als Barenboim mit der Wagner-Ouvertüre anhob, erschien wieder der Sicherheitsmann und wurde handgreiflich. "Die Festvalleitung hat das Filmen hier ausdrücklich verboten", sagte er. "Gut meinetwegen", beruhigten wir ihn, und legten die Kamera in den Schoß. So gut es ging, "zielten" wir weiter auf den dirigierenden Barenboim, während wir mit dem Kopf zum Takt wippten, damit die Sicherheitsleute nicht merken, dass die Kamera weiter läuft. Aus Furcht, dass man uns die Filmkassette wegnehmen könnte, hängten wir die Filmtasche einem anwesenden deutschen Diplomaten über die Schulter, während wir den Saal "mit leeren Händen" verließen. Später beim Bier gratulierte Barenboim, während beim Zweiten Kanal des israelischen Fernsehens schon die Reportage mit den exklusiven Bildern fertig geschnitten wurde. An N-TV wurde der Bericht per Satellit geschickt und als erster Sender ausgestrahlt. Etwas erstaunt fragten ARD und ZDF an, wo denn dieses Filmmaterial herstamme. Am Tag danach meldeten sich die internationalen Fernsehagenturen und sogar die japanische Zeitung Asahi Schinbum. Alle wollten die exklusiven Bilder haben.Ulrich W. Sahm
Landkarte fürs Überleben
Eine "Überlebenskarte" für Israelis hat der Jerusalemer Kartenhersteller "Carta" herausgegeben. Zusammen mit Siedlern und Militärs hat "Carta" eine Landkarte des Westjordanlandes und des Gazastreifens ausgearbeitet, auf der die "relativ sicheren" Durchgangsstraßen eingezeichnet sind. Straßen mit besonderer Lebensgefahr sind durch symbolische "Keine Einfahrt" Schilder auf der Landkarte "gesperrt" worden. An besonders gefährlichen Kreuzungen ist ein gelbes Dreieck mit rotem Ausrufezeichen eingezeichnet. "Fast auf allen Straßen hat es Schüsse, Tote, Steinwürfe oder andere Überfälle gegeben", sagt Verlagsleiter Schai Hausman. Er selber fahre nicht mehr durch das Westjordanland. "Ich habe Kinder", begründet er seinen Beschluss. Das hinderte ihn aber nicht, auf Bitten der Siedler die erste "Überlebenskarte der Welt" zu schaffen. "Ähnliche Verhältnisse wie in den besetzten Gebieten gibt es wohl sonst in der Welt nur in Bosnien", meint Hausman. Die Karte sei "ganz ohne politische Absichten" geschaffen worden. Deshalb sei die "Grüne Grenze" zwischen Israel und dem Westjordanland nicht eingetragen, weil diese Waffenstillstandslinie von 1949 nicht international anerkannt sei. Doch die vertraglich ausgehandelten "A" Gebiete unter voller palästinensischer Kontrolle und die "B" Gebiete im besetzten Land, unter israelischer Sicherheitskontrolle, sind durch Brauntöne kenntlich gemacht worden. "Einem Israeli ist es verboten, die palästinensischen Gebiete zu betreten, weil das lebensgefährlich ist", sagt Hausman. Auf die Straßenschilder sei kein Verlass, weil die Palästinenser sie umdrehen und so möglicherweise israelische Autofahrer in palästinensisches Gebiet lenken. "Vermutlich haben sich die beiden Soldaten wegen verdrehter Straßenschilder nach Ramallah verirrt, wo sie am 12. Oktober in der Polizeistation gelyncht worden sind", meint Hausman. Durchgangsstraßen, auf denen es noch "einigermaßen sicher" sei, obgleich auf ihnen ein griechischer Mönch, mehrere israelische Autofahrer und auch Palästinenser erschossen worden sind, wie etwa die Straße von Jerusalem über Jericho nach Galiläa, sind auf der Überlebenskarte blau schraffiert gekennzeichnet. Doch wird geraten, vor der Abreise bei den ebenfalls eingetragenen Notrufzentralen anzurufen und zu fragen, ob die Straße frei sei. Eingezeichnet sind auch die zahlreichen "ständigen Straßensperren" der israelischen Armee. "Wir hatten befürchtet, dass die Armee vielleicht Einwände gegen unsere Karte erheben könnte, aber innerhalb von zwölf Stunden hatten wir die Freigabe der Zensur", erzählt Hausman und zeigt ein Exemplar der Kartenskizze mit dem Stempel der Militärzensur. Die nur auf Hebräisch gefertigte Karte ist in Buchhandlungen nicht erhältlich. Sie wird direkt an die Siedler verkauft. Deshalb auch eine Anzeige einer Firma, die sich anbietet, Autos zu panzern und die "zeitweilig verschärften" offiziellen Anweisungen der Armee für israelische Autofahrer in den besetzten Gebieten. Da wird empfohlen, "jeden Kontakt mit palästinensischen Polizisten zu meiden". Falls es dennoch dazu kommen sollte, sei darauf hingewiesen, "dass palästinensische Polizisten keinen Israeli verhaften dürfen". Die Fensterscheiben der Autos sollte gegen Steinwürfe gepanzert sein. Wer durch die besetzten Gebiete fahre, sollte möglichst im Konvoi mit mindestens einem anderen Auto fahren, "seine persönliche Waffe tragen" und das Handy dabeihaben.Ulrich W. Sahm