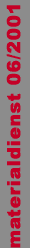Die missbrauchte Stadt
von Amos Elon
Ariel Scharon wusste, was er am 28. September 2000 tat. Wild entschlossen, Ministerpräsident von Israel zu werden, marschierte er auf Jerusalems umstrittenstes Stück Land zu - das erhabene, mit geschliffenen rosa und grauen Steinen gepflasterte Plateau, das die Juden den Tempelberg nennen und die Muslime Haram al-Scharif (nobles Heiligtum). Außer bei den Freitagsgebeten wirkt dieser Platz oft wie ausgestorben. An diesem besonderen Tag traf Scharon unter dem Schutz von fast tausend bewaffneten Polizisten und Soldaten ein. Später behauptete er, er habe nur den "freien Zugang" zum Tempelberg prüfen wollen und ob man dort in Ruhe beten könne. Sein wahres Motiv war jedoch, die Ultrarechten auf seine Seite zu bringen und damit Benjamin Netanjahus Rückkehr zur politischen Macht zu vereiteln. Jassir Arafat musste damals ebenfalls sein Image als Hardliner aufpolieren, denn die Palästinenser waren zunehmend unzufrieden mit ihm. Sie waren demoralisiert durch einen abstrakten "Friedensprozess", der ihnen nicht die geringsten Vorteile brachte, sondern ihr tägliches Leid und die Demütigungen nur verstärkte. Unter Ehud Barak hatten sich noch mehr israelische Siedler im besetzten Westjordanland und in Jerusalem niedergelassen als unter Benjamin Netanjahu. Um gegen Scharons Provokation zu protestieren und sein eigenes lädiertes Image aufzubessern, löste Arafat einen blutigen Palästinenseraufstand aus. Oder zumindest tat er nichts, um ihn zu verhindern. So kam es zum schlimmsten palästinensischen Gewaltausbruch in einem hundertjährigen Konflikt, der jetzt unlösbarer ist als jemals zuvor. Auch Ehud Barak, damals Premierminister, glaubte zu wissen, was er tat, als er Scharons Expedition zu diesem äußerst sensiblen muslimischen Heiligtum gestattete. Nur ein paar Tage zuvor hatte Arafat mit Barak in dessen Privathaus zu Abend gegessen. Im Nachhinein kann man sich das kaum vorstellen. Bei dieser Gelegenheit beschwor Arafat Barak ein letztes Mal, Scharons Besuch zu unterbinden. Barak ließ ihn abblitzen. Auch er hatte bei den Umfragen stark verloren. Seine Koalition war auseinander gebrochen. Er wollte, dass Scharon anstelle von Netanjahu für die Likud-Partei kandidierte. Laut Umfragen sollte er eine kleine Chance haben, Scharon zu besiegen, nicht aber Netanjahu. Barak, ein ehemaliger General, ist hoch intelligent, aber politisch ungeschickt. Sein Hobby ist, komplizierte Uhrwerke auseinander zu nehmen und wieder zusammenzusetzen. Er ist der höchstdekorierte Soldat in der israelischen Armee und ein begabter Pianist. Er hätte wissen sollen, dass auf dem Jerusalemer Haram al-Scharif die Religionskriege unter einem anderen Namen fortgesetzt werden. In Jerusalem ist Hass oft eine andere Art zu beten, besonders dann, wenn Messer gezückt werden und Bomben fallen. Religiöser Hass, auch odium theologicum genannt, gilt schon lange als Instrument zur Erlangung von Macht und Besitz, ob in der Lokalpolitik oder bei Bodenspekulationen. Unablässig und abergläubisch werden "Geschichte" und "Religion" beschworen. Und das nirgendwo so laut wie auf dem Haram oder Tempelberg, wo Scharon seinen Coup inszenierte. Frieden zu schaffen war nie leicht, doch jetzt wird es unendlich viel schwerer. Regelmäßig führen unvorstellbare Gräueltaten an Zivilisten zu mörderischen Rachefeldzügen, die wiederum noch schlimmere Gräuel provozieren. Ein Ende ist nirgends in Sicht. Ist Arafat in der Lage, den Tiger im Zaum zu halten, den er seit fast einem Jahr reitet? Kann man sich wirklich auf Scharon verlassen, wenn es darum geht, Arafat entgegenzukommen, den er "unseren bin Laden" genannt hat? Mittlerweile gibt es Hunderte von Toten und Tausende von Verletzten, die meisten von ihnen Palästinenser. Nach dem amerikanisch-britischen Vergeltungsschlag gegen Afghanistan unternahm Osama bin Laden den leicht durchschaubaren Versuch, den Jerusalem-Konflikt für Propagandazwecke und zur Rekrutierung von Talibankämpfern zu nutzen. Noch ist ungewiss, ob es ihm gelingen wird, die Bemühungen der Vereinigten Staaten zu sabotieren, eine breite Koalition gegen die Psychopathen des internationalen Terrors zu schmieden. Doch bin Ladens Äußerungen könnten auch etwas Gutes haben. Vielleicht erkennt die Bush-Regierung endlich, dass sie sich stärker als bisher um die Wiederaufnahme des gescheiterten palästinensisch-israelischen Friedensprozesses bemühen muss. Der ehemalige israelische Außenminister Schlomo ben Ami, ein Mann mit großer Erfahrung, was die Friedensverhandlungen betrifft, behauptet nach wie vor, beide Seiten seien einfach nicht in der Lage, ihren Konflikt allein beizulegen. Einzig die internationale Gemeinschaft könne eine Lösung finden - auch für Jerusalem. Der arabische Geograf Muqaddasi - der Name bedeutet, dass er in Jerusalem geboren wurde - schrieb im 10. Jahrhundert, dass die Stadt "ein mit Skorpionen gefülltes goldenes Becken" sei. Denn die heiligen Stätten liegen größtenteils in der von Mauern umgebenen Altstadt, nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Für orthodoxe Juden erstreckt sich die Heiligkeit von Jerusalem jedoch weit über die ummauerte Altstadt hinaus. Denn nach orthodoxer Lehre ist alles, was man von einem hohen Turm aus sehen kann, Teil des heiligen Territoriums. Nach 1948 wurden alle Synagogen, die unter jordanische Herrschaft fielen, zerstört. Dennoch waren nicht religiöse, sondern politische Überlegungen ausschlaggebend für die neuen Stadtgrenzen Jerusalems, die nach der Annektierung des ehemaligen jordanischen Sektors als Folge des Krieges von 1967 gezogen wurden. Diese Grenzen umschließen heute rund 240 Quadratkilometer und damit einen großen Teil des früheren jordanischen Stadtteils (Ostjerusalem). In Großjerusalem leben heute rund 600 000 Menschen, davon sind 68 Prozent Israelis und 32 Prozent Palästinenser. Die Grenzen sollten so viele Israelis und so wenige Palästinenser wie möglich fassen. Da die palästinensische Bevölkerung jedoch viel rascher wächst, mehren sich schon seit langem die Zweifel, ob es bei der israelischen Mehrheit bleibt, selbst wenn man, was wahrscheinlich ist, das Stadtgebiet weiter vergrößert, um die neuen israelischen Satellitenstädte einzugliedern, die nach 1967 auf palästinensischem Land errichtet wurden. Israelis waren nicht die Einzigen in den vergangenen Jahren, die religiöse Symbole agitatorisch für politische Zwecke missbraucht haben. Wenn es um Jerusalem ging, hatte die nationalistische Rhetorik auf beiden Seiten immer etwas Wahnhaftes. Als der jetzige Bürgermeister, Ehud Olmert, Mitglied der Likud-Partei, neulich von einem Reporter gefragt wurde, warum die städtischen Dienstleistungen im arabischen Teil Jerusalems so schlecht seien, antwortete er verärgert, es gebe kein arabisches, nur ein "jüdisches Jerusalem". Scharon nennt Jerusalem "Israels Hauptstadt, auf ewig vereint". Der verstorbene Ministerpräsident Menachim Begin, der nach seinem dramatischen Rücktritt infolge des verheerenden Libanon-Krieges seine letzten Jahre schwer depressiv und allein in einem verdunkelten Zimmer verbrachte, war einer der Ersten, der diese Parole ausgab. Er tat das mit ekstatischer, schriller Stimme. Anfang der achtziger Jahre beschloss Begin, ein zweites Annektierungsgesetz einzubringen, um in der Jerusalem-Frage nicht von noch extremeren Nationalisten überholt zu werden. Darin wurde - überflüssigerweise - proklamiert, dass ganz Jerusalem (inklusive der palästinensischen Stadtteile) auf "ewig" zu Israel gehöre. Er brachte das Gesetz durch die Knesset. Der Sprecher der Arbeiterpartei erklärte es für überflüssig und warnte sogar davor, dass es Schaden anrichten könnte. Dennoch stimmten die Mitglieder der Arbeiterpartei in der Knesset dafür. Jitzhak Rabin blieb der Abstimmung fern und stritt mit Schimon Peres über die Unterstützung des Gesetzes durch die Arbeiterpartei. Bis heute ist Peres ein politischer Falke in der Jerusalem-Frage. Das einzige Ergebnis des zweiten Annektierungsgesetzes war, dass die wenigen in Westjerusalem vertretenen ausländischen Botschaften aus Protest nach Tel Aviv umzogen. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete eine Resolution, in der Israel für die Annektierung verurteilt wurde - mit vierzehn zu null Stimmen. Die Vereinigten Staaten enthielten sich. Ich fragte damals Begin, ob man seiner Ansicht nach die "Ewigkeit" in ein Gesetz gießen könne. "In diesem Falle kann und muss man das", fuhr er mich an. Ich fragte ihn, ob auch er der weit verbreiteten Ansicht sei, Jerusalem müsse bei den Verhandlungen hintangestellt werden, andernfalls werde es nie zu einer Einigung zwischen Arabern und Israelis kommen. Begin blickte auf und sagte streng: "Jerusalem wird niemals auch nur Verhandlungsthema sein!" Eine rationale Lösung der Probleme, die aus zwei unversöhnlichen Nationalismen erwachsen, wäre gewesen, die gesamte Stadt unter internationale Verwaltung zu stellen. Diese Empfehlung stand tatsächlich in der ursprünglichen UN-Teilungserklärung von 1947. Israel akzeptierte sie, die arabischen Länder nicht. Letztere erklärten 1947 dem neuen Staat den Krieg. Nach dem Sieg der Juden änderte der neue Staat Israel seine Meinung in der Jerusalem-Frage. In einem Geheimabkommen verständigten sich Israel und Jordanien darauf, die Stadt zu teilen. Golda Meir und König Abdallah einigten sich, noch bevor die Waffen schwiegen. Keiner von beiden dachte dabei an die Palästinenser. Jordanien versprach den Israelis freien Zugang zur Klagemauer, hielt jedoch sein Versprechen nicht. Minenfelder und hohe Mauern mit Stacheldraht trennten den israelischen Teil Jerusalems vom jordanischen. Theoretisch ist es immer noch eine attraktive Lösung, die Stadt unter internationale Verwaltung zu stellen. Es schiene so vernünftig. Doch weder Israelis noch Palästinenser werden dem wohl jemals zustimmen. Sie wären nicht einmal damit einverstanden, die Altstadt, in der sich die meisten heiligen Stätten befinden, unter internationalen oder eventuell binationalen Schutz zu stellen. Schließlich war bis dato Generationen von Palästinensern und Israelis von ihren politischen und religiösen Führern mit aller Macht eingebläut worden, das historische Zentrum gehöre ausschließlich ihnen. Die frühen Zionisten waren klüger als ihre Kinder und Kindeskinder. Wie die meisten europäischen Nationalisten der liberalen Schule wehrten sie sich gegen religiöse Bevormundung. Theodor Herzl, der Begründer des modernen Zionismus, dachte gar nicht daran, seinen einzigen Sohn beschneiden zu lassen. Er befürwortete die Internationalisierung Israels. Als Hauptstadt des von ihm vorgeschlagenen säkularen "Judenstaates" bevorzugte er Haifa, eine Stadt mit Blick aufs Mittelmeer. Jerusalem, fand er, rieche nach Fanatismus und Aberglaube, den Ablagerungen von "zweitausend Jahren Unmenschlichkeit und Intoleranz". Chaim Weizmann, Israels erster Präsident, teilte Herzls Ansicht. Er war ein ausgesprochen rationaler Mann. Jerusalem mochte er nicht. Rabbis, die sich in Politik einmischten, und Politiker, die mit religiösen Leidenschaften spielten, stießen ihn ab. Als 1937 der erste Teilungsplan für Palästina vorgestellt wurde, schlug er vor, nur einige der modernen, von Juden bewohnten Stadtteile Jerusalems in den geplanten jüdischen Staat mit aufzunehmen. Die Altstadt wollte er "nicht mal geschenkt bekommen". Zu viele "Komplikationen und Schwierigkeiten" seien damit verbunden. Noch während er diese Worte niederschrieb, kam es in Jerusalem nahe der Klagemauer zu Zusammenstößen zwischen "Braunhemden" der Betar, einer rechtsgerichteten, paramilitärischen jüdischen Jugendbewegung, mit arabischen Fundamentalisten. Die Betar verstärkte die Befürchtung der Araber - damals nichts als ein Mythos -, dass die Zionisten planten, die Moscheen auf dem Haram abzureißen und den jüdischen Tempel wiederaufzubauen. Die frühen Betar-Extremisten, Vorläufer von Begins Likud-Partei, wurden damals von den meisten palästinensischen Juden als Faschisten abgetan. Nach unserem Kenntnisstand dachte zu jener Zeit nicht einmal die Betar an die Möglichkeit, dass der jüdische Staat, für den sie kämpften, eines Tages die Alleinherrschaft über den Haram beanspruchen würde, einen Ort, der seit 14 Jahrhunderten als drittheiligste Stätte des Islam gilt. Die Asche einer roten Kuh Die Idee, den Tempel an seiner antiken Stätte wiederaufzubauen, ruhte bis zum Krieg 1967. Nach der israelischen Besetzung von Ostjerusalem tauchte sie plötzlich wieder auf. Israelische Fallschirmjäger hissten die Landesflagge über dem heiligen Felsen, der jetzt von einer großen Moschee umschlossen wird und auf dem sich von Abraham bis zu Mohammeds Zeiten Religionen, Mythen und Aberglauben unter anderen religiösen und politischen Bedeutungsschichten übereinander gelagert haben. Mohammed soll von dort gen Himmel gefahren sein. Als der damalige Verteidigungsminister Mosche Dajan die Flagge entdeckte, ordnete er sofort an, sie zu entfernen. Er befahl den Truppen, die Moschee zu räumen und sie den muslimischen Wächtern zurückzugeben. Doch an diesem Tag lieferte Schlomo Goren, Oberrabbiner der israelischen Armee und Offizier im Rang eines Generalmajors, Dajan einen ersten Vorgeschmack darauf, wie widerwillig seine klugen Befehle auch in Zukunft befolgt werden sollten. Ähnlich wie Scharon 33 Jahre später marschierte Goren in Begleitung von singenden Soldaten auf den Haram. Er bekam einen Verweis. Damals waren die Araber noch zu eingeschüchtert, um sich zu wehren. Zerah Warhaftig, israelischer Minister für religiöse Angelegenheiten, den ich zwei Wochen später interviewte, sagte mir, der Tempel sei seit den Tagen König Davids "zivilrechtlich" jüdisches Eigentum, denn dieser habe dem Jebusiten Araunah "den vollen Preis (fünfzig Silberschekel)" dafür bezahlt. Doch er sei ein geduldiger Mensch, fügte er schelmisch lächelnd hinzu, und bereit, seine Besitzansprüche bis zur Ankunft des Messias zurückzustellen. Wir könnten von Glück reden, sagte der Minister, dass der Talmud Juden verbiete, den Tempelberg zu betreten, da ihre rituelle Unsauberkeit nur durch die Asche einer roten Kuh, einer seltenen, mittlerweile ausgestorbenen Spezies, überwunden werden könne. Das erspare Israel unnötige Scherereien mit den Arabern. Andere waren weniger weise als dieser altmodische orthodoxe, aber für Frieden streitende Politiker, der für seine mäßigende Haltung bekannt war. Kurz danach kam es zu Rangeleien zwischen den muslimischen Wärtern und säkularen wie religiösen Juden. Im August 1967, am Gedenktag der Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahre 70, betrat Generalmajor Goren den Berg erneut mit einer Thoraschriftrolle, einem Thoraschrein und einem Pult. Er errichtete eine provisorische Synagoge zwischen dem Dom und der Al-Aksa-Moschee und hielt einen Gebetsgottesdienst ab. Der israelischen Polizei gelang es nicht, ihn daran zu hindern. Einige Polizisten hätten dem Gottesdienst beigewohnt, hieß es später. Kurze Zeit darauf nahm Generalmajor Goren seinen Abschied von der Armee und wurde zum Oberrabbiner von Israel ernannt. Da der orthodoxe Judaismus in Israel Staatsreligion ist, kommt das einem Regierungsposten gleich. Goren ordnete unverzüglich an, dass die von Warhaftig am Eingang zum Tempelberg angebrachten Schilder entfernt werden, auf denen Juden nach den Gesetzen des Talmuds das Betreten des Geländes untersagt wird. Gorens Ernennung verlieh dem Hohen Rabbinat eine politische Militanz, die es nie zuvor gehabt hatte. Als Oberrabbiner bekämpfte Goren Warhaftigs Ansicht, dass das Betreten des Tempelbergs für orthodoxe Juden verboten sei. Er argumentierte, große Teile des Harams seien für die Muslime "nicht so heilig" wie für die Juden und sollten zum Bau einer Synagoge zur Verfügung gestellt werden. In einer besonders provokanten Erklärung behauptete er, die Muslime hätten selbst den Beweis dafür geliefert, indem sie ihre Schuhe nur innerhalb der beiden Moscheen auszögen, nicht aber auf dem sie umgebenden Platz. Milde Strafen für Verschwörer Seit Ende der sechziger Jahre kam es in der Nähe des Tempelbergs immer häufiger zu Zusammenstößen und Prügeleien zwischen Palästinensern und Israelis. Jugendliche Anhänger von Meir Kahane, die T-Shirts mit der Aufschrift "Das Volk Israel lebt" trugen, schmierten Davidsterne auf die Außenwände von Moscheen und brüllten Obszönitäten in den engen Gassen zum Haram. In der Altstadt wurde ein Institut gegründet, das sich dem Wiederaufbau des Tempels widmete. Darin befand sich auch ein Seminar für Priester, die auf dem Tempelberg Tieropferriten vollziehen sollten. Das Unternehmen wurde gesponsert von christlichen Fundamentalisten aus Amerika, amerikanisch-jüdischen Geldgebern und insgeheim mindestens einmal von der israelischen Regierung. Die arabische Stadtverwaltung des früheren jordanischen Sektors wurde aufgelöst, der palästinensische Bürgermeister nach Jordanien ausgewiesen. Seine ehemaligen Mitarbeiter weigerten sich jedoch, dem israelischen Stadtrat unter Bürgermeister Teddy Kollek beizutreten. Über Nacht wurden sämtliche Bewohner eines muslimischen Viertels nahe der Klagemauer vertrieben, ohne eine Entschädigung zu erhalten. Mit Kolleks voller Unterstützung wurden ihre Häuser abgerissen, um Platz für eine riesige Versammlungsfläche zu schaffen. Ein Reporter, Herbert Pundik von der hebräischen Tageszeitung Davar, sagte in einem Interview mit dem Bürgermeister, er fände es ungeheuerlich, den verhältnismäßig intimen Ort, wo Hunderte von Jahren gebetet worden war, zu einer "riesigen, lärmenden Piazza del Populo" zu verschandeln, wo Kundgebungen israelischer Nationalisten und die Vereidigung von Armeerekruten stattfinden sollten. Kollek war anderer Meinung: "Es war das Beste, was wir tun konnten." Und fügte, bezeichnend für die neue Stimmung, hinzu: "Der alte Platz hatte etwas von einer Diaspora, er war eine Art Klagemauer. In der Vergangenheit war das sinnvoll. Doch die Zukunft wollen wir anders anpacken." Zwei Jahre nach dem Sechstagekrieg steckte ein geistig verwirrter christlicher Fundamentalist aus Australien die Al-Aksa-Moschee in Brand. Die Zerstörung der Moschee werde das tausendjährige Reich herbeiführen. Das Feuer verursachte erheblichen Schaden und zerstörte wertvolle Kunstwerke aus dem 12. Jahrhundert. Im besetzten Westjordanland, im Gaza-Streifen und in Ostjerusalem gingen daraufhin Demonstranten auf die Straße. 1982 schoss sich ein ebenfalls geistesgestörter Amerikaner, ein "wiedergeborener" Jude, den Weg frei in den Felsendom. Er trug eine israelische Uniform und war mit einem automatischen M-16-Gewehr bewaffnet. Er diente als Freiwilliger in der israelischen Armee, die ihm die Waffe verschafft hatte. Sein Ziel, so verkündete er, sei, den Berg zu "befreien" und König der Juden zu werden. Infolge dieser Bluttat kam es zu Unruhen, die sich bis in ferne muslimische Länder Asiens und Afrikas ausbreiteten und mit kurzen Unterbrechungen mehrere Wochen andauerten. Jüdische Fundamentalisten, wild entschlossen, für die historische "Alleinherrschaft" Israels zu kämpfen, versuchten weiterhin, auf den Tempelberg zu gelangen. Das Oberste Gericht unterstützte die Regierung in ihrem Bemühen, sie davon abzuhalten. Das gelang nicht immer. Die Likud-Partei und andere säkulare Politiker rechts von ihr nahmen sich der Gesetzesbrecher an. Geschützt durch ihre parlamentarische Immunität, konnten sie ungestraft politische Demonstrationen auf dem Tempelberg veranstalten. Mehrere geheime Verschwörungszirkel wurden rechtzeitig von der Polizei aufgedeckt. Einige der Verschwörer wurden in flagranti oder noch am Vorabend ihres Versuches erwischt, den Tempelberg in die Luft zu sprengen. Andere wollten gewaltsam eindringen und den "Grundstein" für den neuen Tempel legen. Wieder andere versuchten, das alte Ritual des Tieropfers neu zu beleben. Das Gericht verhängte meist milde Strafen über die Verschwörer, wegen Sprengstoffbesitzes und ähnlicher Vergehen. Einige von ihnen waren bekannte Persönlichkeiten, die in den neuen Siedlungen jenseits der alten Demarkationslinie politisch aktiv waren. Wer in flagranti ertappt wurde, erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe, die jedoch schnell umgewandelt wurde. Denn prominente Likud-Politiker, darunter auch der ehemalige Premierminister Jitzhak Schamir, appellierten an den Staatspräsidenten, um Strafmilderung zu erreichen - mit Erfolg. Den schwersten Delinquenten gewährte Präsident Chaim Herzog, Mitglied der Arbeiterpartei, Amnestie. Wenige Jahre später kamen alle frei. Die Annektierung des ehemaligen jordanischen Sektors von Jerusalem wurde weder von den Vereinigten Staaten noch von einem anderen Land anerkannt. Dennoch ließen die Proteste der Amerikaner im Laufe der Jahre nach und verstummten schließlich ganz, während ein US-Präsident nach dem anderen im Wahlkampf rituell versprach, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Dies geschah nie, aber die amerikanische Unterstützung für Israels Ansprüche wurde immer intensiver. In Israel selbst, nach dem Sieg in jenem Krieg, den man in Anlehnung an die sechs Schöpfungstage "Sechstagekrieg" nannte, war die öffentliche Meinung überwiegend für die Annektierung des arabischen Stadtteils. Politisch aktive Israelis, in den meisten anderen Fragen heillos zerstritten, waren sich niemals so einig wie in dieser Frage. Die Annektierung wurde gemeinhin als moralisches und historisches Recht bezeichnet, als Israels "manifest destiny". Die Araber und der Rest der Welt, hieß es, müssten lernen, damit zu leben. Nur zwei Minister der regierenden Nationalen Koalition waren anderer Meinung: Erziehungsminister Salman Aranne von der Arbeiterpartei und Innenminister Mosche Schapiro, eine politische Taube von der Nationalreligiösen Partei. Beide stimmten im Kabinett gegen die Besetzung des jordanischen Sektors durch die Armee als Vergeltung für sporadische Bombenattentate, weil sie befürchteten, dass dies zu einem Konflikt führen könnte, dessen Ende nicht abzusehen wäre. Die Abstimmung war geheim. Erst nach ihrem Tod wurde ihr Veto öffentlich bekannt. Die Annektierung von Ostjerusalem erwies sich als eine der populärsten Maßnahmen der israelischen Regierung. Im Juni 1967 schalt Gerschom Schocken, Chefredakteur der unabhängigen liberalen Zeitung Ha'aretz, die Regierung, das nicht schon viel eher getan zu haben. Heute spricht sich dieselbe Zeitung für einen Rückzug aus großen Teilen des Westjordanlands und Ostjerusalems aus und plädiert dafür, den Palästinensern das Alleinrecht über den Tempelberg zu geben. Doch im Sommer 1967 wurde nicht nur Schocken, sondern wurden auch die meisten seiner Mitarbeiter von einer Euphorie über einen Sieg überwältigt, der verblüffend, unerwartet und scheinbar vollkommen war. Ich erinnere mich an eine Redaktionskonferenz, vielleicht eine Woche nach dem Waffenstillstand. Schocken machte seiner Ungeduld über die zögernde, abwartende Haltung der Regierung Luft. "Feiglinge! Worauf in aller Welt warten die noch?", rief er. Der jordanische Teil von Jerusalem und sein Hinterland müssten sofort annektiert werden. Der jüngste unter den versammelten älteren Redakteuren wagte die Bemerkung, dass man die Palästinenser nicht zwingen könne, gegen ihren Willen Israelis zu werden. Sie hätten dasselbe Recht auf nationale Selbstbestimmung wie die Juden. Ein anderes Redaktionsmitglied, ein älterer, ehemaliger Staatsrechtler aus Frankfurt am Main, der die Weimarer Republik erlebt hatte und auf Verfassungsrecht spezialisiert war, gab zu bedenken, dass die geplante Annektierung gegen das Kriegsrecht und internationale Konventionen verstoße, die Israel selbst unterzeichnet hatte. Beide wurden von ihren Kollegen ausgebuht. Alle anderen Tageszeitungen vertraten dieselbe Meinung, mit Ausnahme der kommunistischen Kol Ha'am. Fast das gesamte literarische Establishment, allen voran der Literaturnobelpreisträger S. Y. Agnon, unterstützte das extremistische Manifest, das die neue "Bewegung für ein Groß-Israel" herausgegeben hatte. Darin wurde die unverzügliche Annektierung nicht nur des arabischen Teils von Jerusalem, sondern aller besetzten Gebiete gefordert, einschließlich der Sinai-Halbinsel, der Golanhöhen und des gesamten Westjordanlands. Eine Ausnahme war der junge Schriftsteller Amos Oz. Nach einem ersten Besuch der Jersualemer Altstadt verriet er einem Journalisten, er fühle sich wie in einer "fremden Stadt" (Ir z'ara). Nur drei prominente Universitätsprofessoren sprachen sich damals gegen alle Annektierungen aus. Der Biophysiker Jeschajahu Leibowitz - ein orthodoxer Jude - verspottete den Kult der Klagemauer als heidnische Steine-Anbetung. Die geplanten Annektierungen würden Israel in einen "Polizeistaat" verwandeln. Die Historiker Jehoschua Arieli und Jehoschuha Talmon schlossen sich seiner Meinung an. Die Erfahrung der Franzosen in Algerien, behaupteten beide, sollte Israel als warnendes Beispiel dienen. Israelis könnten genauso verrohen und korrupt werden wie viele der französischen Siedler in Algerien, die versucht hatten, ein fremdes Volk gegen seinen Willen zu beherrschen. Diese Befürchtungen sollten leider wahr werden. In den darauf folgenden Jahren war Jerusalem nur theoretisch "vereint". Zwischen Palästinensern und Juden gab es kaum soziale Kontakte, keine Eheschließungen und keine nennenswerten wirtschaftlichen Beziehungen, außer vielleicht in der kriminellen Unterwelt oder zwischen dem israelischen Geheimdienst und seinen bezahlten Kollaborateuren und Spionen. Dass so viele Palästinenser ihre Landsleute bespitzelten, machte sie in den Augen vieler Israelis noch verachtenswürdiger. Jerusalem hatte noch immer zwei Stadtzentren, zwei Geschäftszentren, zwei öffentliche Transportsysteme, zwei Elektrizitätswerke und zwei Sozialsysteme. Und das war beileibe kein "Mosaik", wie Kollek es oft nannte. Mosaiken folgen in ihrem Muster einer gewissen Harmonie. In diesem Fall reflektierte die Teilung nur Diskriminierung und eine immer tiefer werdende Kluft. Bei der Verteilung der öffentlichen Gelder auf die israelischen und die palästinensischen Viertel herrschte große Ungleichheit. Die Besitzansprüche von Juden auf Eigentum aus der Zeit vor 1948, das jenseits der ehemaligen Demarkationslinie lag, wurden ohne weiteres anerkannt. Umgekehrte Besitzansprüche von Palästinensern im israelischen Stadtteil wurden vertagt oder abgewiesen. Das extremistische Manifest Trotz wiederholter Warnungen, dass eine ungleiche Behandlung der Palästinenser in Bezug auf Bildung, Wohnungspolitik, Gesundheitsvorsorge und andere Sozialleistungen verheerende Folgen haben könnte, blieb es bis heute bei der Diskriminierung. Kollek beklagte das oft, doch bei der Verteilung der Steuergelder, die er in beiden Teilen der Stadt eintrieb, behandelte er die Palästinenser genauso ungerecht, wie es die Regierung tat. Kollek galt als "Liberaler". Sein Liberalismus war jedoch oft nur ein erfolgreicher PR-Trick, um Gelder aus dem Ausland für seine Jerusalem-Stiftung einzustreichen. Die Stiftung förderte zwar auch einige Projekte für die Palästinenser, doch im Grunde war sie so ausgrenzend wie die Stadtverwaltung. Palästinenser bekamen keine Baugenehmigungen. Blieben sie länger als ein oder zwei Jahre im Ausland, lief ihre Aufenthaltsgenehmigung aus. Ohne Israels militärische Übermacht wäre die Stadt auseinander gefallen. Trotz dieses Ungleichgewichts herrschte Arafat indirekt ab 1994 von Tunis aus über die palästinensischen Viertel. Mit der vertraglichen Konstituierung der palästinensischen Autonomiebehörde 1994 unterstanden sie praktisch und politisch - wenn auch noch nicht rechtlich - den neuen palästinensischen Sicherheitsorganen. Der mächtige israelische Staat war nicht in der Lage, beizeiten die Grenzen seiner Macht zu erkennen. Immer wieder wurden Hoffnungen geschürt, "Lösungsvorschläge" für eine gemeinsame Regierung der Stadt unterbreitet. Einige davon waren nichts als Hirngespinste, über die Jahre ersonnen von wohlmeinenden Akademikern, die ständig in der Welt hin- und herflogen und ihre Genesungsvorschläge in hübschen Orten Europas oder Amerikas feilboten. Nein, an gutem Willen auf beiden Seiten mangelte es nicht. Doch vergebens. Die verschiedenen "Lösungsvorschläge" wären vielleicht sinnvoll in gemischten Städten an der belgisch-holländischen Grenze. Sie können aber nicht recht funktionieren bei zwei Völkern, die sich auf dem gefährlichen Höhepunkt eines hundertjährigen Krieges befinden. Allein in Jerusalem wurden in den vergangenen Jahren 200 000 Israelis jenseits der alten Demarkationslinie auf ein Gebiet umgesiedelt, das man den palästinensischen Eigentümern weggenommen hatte. Die meisten Israelis halten es jetzt für undenkbar, dass die Siedler von dort wieder wegziehen. Weitere 200 000 wurden von der Regierung im Westjordanland und im Gaza-Streifen angesiedelt oder subventioniert. Baraks überraschende Großzügigkeit in Camp David in der Jerusalem-Frage ging jedenfalls nicht darüber hinaus, den Palästinensern ein paar versprengte Enklaven anzubieten, die aber vom palästinensischen Staat abgetrennt und untereinander noch einmal durch israelischen Wohnsiedlungen zerstückelt werden sollten. Barak bot den Palästinensern die Hoheitsrechte über ihre Moscheen auf dem Tempelberg an, aber nicht über den Boden, auf dem sie standen. Stattdessen verlangte er, angeblich mit Rückendeckung der Amerikaner, einen Platz auf dem Haram für die Errichtung einer jüdischen Synagoge. Für das wenige, das er den Palästinensern geboten hatte, wurde er von Scharon schärfstens attackiert. Sogar Peres kritisierte ihn. Scharon selbst hat ein arabisches Haus im Herzen des muslimischen Viertels der Altstadt gepachtet, hält sich aber nur selten dort auf. Überall in Großjerusalem leben Juden und Palästinenser heute in einem Flickenteppich von Enklaven, die ihrerseits in Enklaven liegen. Man kann sich nur schwer vorstellen, sie dort herauszureißen, um die Stadt wieder neu aufzuteilen. Der kurioseste Vorschlag, den ich gehört habe, lautet, die Palästinenser könnten doch das nahe gelegene Dorf Abu-Dis zu ihrer Hauptstadt erklären. Sollten sie es doch einfach in Jerusalem oder al-Quds umbenennen und fortan in Frieden leben. Die traurige Wahrheit ist, dass Jerusalem nicht länger sinnvoll geteilt werden kann, wenn beiderseits nur eine Hand voll Idealisten bereit ist, die Stadt "gemeinsam" im Frieden zu genießen oder sich mit der bloßen Aufsicht und Benutzung (ohne endgültige Festlegung souveräner Rechte) zufrieden zu geben. Das Leben in Jerusalem war traurig in den Jahren zwischen 1967 und 1999. Die Gewalt uferte aus. Nach jeder Ausschreitung brausten Autos der Stadtreinigung heran, auf denen in drei Sprachen "Jerusalem Stadt des Friedens" stand. Mit Lappen und Besen schrubbte die Putzkolonne das Blut von den Pflastersteinen, um den Touristen wieder Normalität vorzugaukeln. Doch es gab auch hoffnungsvolle Momente: 1990 fassten sich etwa 30 000 Israelis und Palästinenser an der Hand und bildeten eine lange Menschenkette um die Mauern der Altstadt. Sie ließen Ballons steigen und sangen "Wir wollen Frieden". Doch so etwas kam selten vor. Selbst die Menschenkette nahm ein böses Ende, als die Polizei versuchte, palästinensische Jugendliche gewaltsam auseinander zu treiben, die "nationalistische Parolen" skandierten. Das war damals noch illegal. Rund dreißig Menschen wurden verletzt, eine Frau verlor ein Auge. In der Altstadt war die allgegenwärtige Spannung mit Händen greifbar. Manchmal fühlte man sich wie in einer hermetisch abgeriegelten Festung. Es mutete grotesk an, dass dieser mit Zwietracht übersäte Ort jemals zur sprichwörtlichen Stadt des Friedens erklärt worden war. Ein Großteil der Altstadt sah noch immer so aus, wie die Kreuzritter und die Türken ihn zurückgelassen hatten. Die Kreuzritter hatten geglaubt, hier auf ewig zu bleiben, und schichteten gewaltige Mauern auf. Auch die Israelis bauten beachtliche Konstruktionen innerhalb und außerhalb dieser Mauern, doch die Gebäude wurden hastig hochgezogen und sind nicht so massiv. Zudem sehen sie um einiges hässlicher aus. Die größeren israelischen Projekte in Ostjerusalem bestanden aus Hochhäusern und der wiederaufgebauten Universität auf dem Skopus-Berg, lieblos hingeklotzt unter dem Einfluss des damals modernen brutalen Architekturstils. Man staunte oft über die vielen hässlichen Gebäude, die zahlreichen Schandflecken und Umweltsünden im Namen der unsterblichen "Liebe" zu Jerusalem, Israels ewiger Hauptstadt. Die neue Universität auf dem Skopus-Berg ist besonders geschmacklos. Touristen verwechseln sie oft mit einer Festung oder einer militärischen Anlage, da sie so kleine, eigenwillig geformte Fenster hat, die wie Schießscharten aussehen. Die neuen Räumlichkeiten haben das Leben auf dem neuen Campus schwer gelähmt. Die riesigen, grottenartigen Räume und Durchgänge sind windig und oft menschenleer. Nur wenige Professoren benutzen ihre merkwürdig geschnittenen Arbeitszimmer. Die meisten eilen zurück nach Westjerusalem, sobald ihre Kurse vorüber sind. Obwohl die Universität auf einem Hügel liegt, der eine fantastische Aussicht auf die Stadt bietet, blickt man aus vielen Fenstern nur auf Mauern. Gehirnwäsche an Teenagern Ohne die Annektierung Ostjerusalems 1967 und ohne die Ansiedlung von 200 000 Israelis im ehemals jordanischen Stadtteil hätte Israel Anfang der siebziger Jahre mit Jordanien Frieden schließen können. Doch das wollte oder konnte Israel nicht. Seitdem ist es Israel nicht gelungen, das Paradox zwischen einer unablässig wachsenden militärischen Macht und einer immer mangelhafteren inneren Sicherheit aufzulösen. Die Gründe dafür sind politisch: Hier versucht ein Volk, ein anderes gegen seinen Willen zu beherrschen. Das kann man nicht vom Tisch wischen, auch wenn die Vereinigten Staaten nach den schrecklichen Terroranschlägen von New York und Washington bereit sein mögen, sich jetzt noch entschiedener einzumischen als in der Vergangenheit. Dass das Leben in Jerusalem damals so traurig war, lag auch an den mangelnden zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern. Auf beiden Parteien lag der Fluch absoluter Selbstgerechtigkeit. Beide schworen, sie seien die Opfer - und würden selbst nie jemandem etwas zuleide tun. Nur wenige Israelis empfanden auch nur einen Hauch von Schuldgefühlen, dass ihr erstaunlicher materieller, gesellschaftlicher und internationaler Erfolg auf Kosten der Palästinenser zustande gekommen war, die sie heimatlos gemacht hatten. Doch ohne den europäischen Antisemitismus würde Israel vermutlich gar nicht existieren. Die Palästinenser waren zwar nicht schuld am Zusammenbruch der Zivilisation in Europa unter den Nazis, doch am Ende wurden sie dafür bestraft. Die moralische Kurzsichtigkeit der Israelis wurde noch verschärft durch die Tatsache, dass die arabischen Staaten die palästinensischen Flüchtlinge ebenso schlecht behandelten und für ihre eigenen Zwecke ausbeuteten. Außer in Jordanien blieben Palästinenser bis in die dritte Generation staatenlos. Das Machtverhältnis zwischen Israelis und Palästinensern fiel immer so überwältigend zugunsten Israels aus, dass jegliche Empathie unter den Palästinensern für das Volk, das sie unterdrückte, bereits im Keim erstickt wurde. Erst recht, wenn - als unverhältnismäßige Strafaktion für Ausschreitungen von Palästinensern in israelischen Städten - wieder einmal Raketen aus modernen Flugzeugen, Panzern und Kampfhubschraubern wahllos auf Palästinenser abgefeuert wurden. Andererseits habe ich noch nie jemanden im palästinensischen Lager getroffen, der ernsthaft darum besorgt wäre, dass die PLO die grausamste nationale Befreiungsbewegung der Neuzeit sein könnte. Sie ist gewiss die einzige nationale Befreiungsbewegung, die bereit ist, überall auf der Welt brutal zuzuschlagen und nicht nur ihre vermeintlichen Unterdrücker, sondern auch Menschen in anderen Ländern zu töten, zum Beispiel 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Unter anderem sprengten die Palästinenser eine Schweizer Passagiermaschine in der Luft. Sie entführten oder bombardierten aber auch andere Flugzeuge und töteten dabei Österreicher, Amerikaner, Deutsche, Franzosen, Türken und Spanier. Man hört auch keine Kritik von irgendeiner palästinensischen Menschenrechtsbewegung an den selbst ernannten "Heiligen", die leicht beeinflussbare Teenager durch Gehirnwäsche davon überzeugen, dass sie als Märtyrer zu Ruhm kommen und im Paradies von wunderschönen Frauen verwöhnt werden, wenn sie sich nur in einer gut besuchten Diskothek zusammen mit anderen Jugendlichen in die Luft sprengen. Oder in einem voll besetzten Fast-Food-Restaurant, zehn Minuten vom heiligen Haram entfernt. Die politische Sackgasse verläuft parallel zum beidseitigen Mangel an Empathie. Dem neuen Friedenswillen zum Trotz, stellte eine Karikatur auf der Leitartikelseite des liberalen Ha'aretz erst kürzlich die gegenwärtige Intifada als ekelhaftes Ungeziefer dar, das einen menschlichen Körper zerfressen will. Ich sah nur einen Brief eines Lesers, der sich beim Herausgeber der Zeitung beschwerte. Der Brief kam von Klement Messerschmidt, einem in Jerusalem lebenden Deutschen. Messerschmidt protestierte gegen die krasse Entmenschlichung der Palästinenser in jener Zeichnung, die an berüchtigte Nazikarikaturen erinnerte. "War denn niemandem bei Ha'aretz unwohl bei dieser überfrachteten Metapher?" Es ist zum Verzweifeln. © The New York Review of Books, 18. Oktober 2001, aus: DIE ZEIT, 11. Oktober 2001 Aus dem Englischen von Sigrid Weise