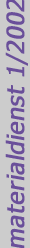Die Schüler des Terrors
von Bruno Schirra
Sie tragen Sprengstoff am Gürtel. Sie wollen töten. Palästinensische Jugendliche opfern ihr Leben für den Kampf gegen Israel. Dafür werden sie im Gaza-Streifen als Helden gefeiert und von ihren Eltern verehrt. Besuch in Ausbildungslagern der Selbstmordattentäter Diese Geschichte ist eine Geschichte vom Töten, also gibt es keinen Anfang und kein Ende. Aber wenn diese Geschichte an einem bestimmten Punkt beginnen soll, dann vielleicht am Morgen des 5. Oktober 2001, als der 26 Jahre alte Palästinenser Nidal Mohammad Qafisheh vor seinem Haus in Hebron binnen weniger Sekunden Kopf und Arme verliert. Er trägt einen Pyjama, als er stirbt. Die Rakete, die ihn zerfetzt, wurde abgefeuert aus einem israelischen Hubschrauber, der sich in enger werdenden Kreisen an sein Haus herangetastet hatte. Vermutlich war es das Dröhnen der Rotorblätter, das Qafisheh aus dem Bett und vors Haus getrieben hat. Der abgerissene Kopf kullert noch einige Meter, bevor er liegen bleibt. Mit Qafisheh sterben an diesem Morgen vier weitere Männer, 22 bis 43 Jahre alt. Die Getöteten trugen Zivil, was die Vermutung nahe legt, die Toten seien Zivilisten gewesen. Die israelische Armee aber erklärt später, zumindest zwei der Toten hätten zuvor auf dem Platz vor der Ma'arat Machpala, der Grabstätte des jüdischen Patriarchen in Hebron, auf jüdische Männer, Frauen und Kinder geschossen. Am Abend vor seinem Tod hatte Qafisheh selber noch dem Reporter amüsiert erzählt, "dass die Juden wie aufgescheuchte Hasen über den Platz gejagt wurden". Jetzt liegt seine Leiche in einer Blutlache. Ein Torso in einem Pyjama. Einige Stunden vergehen, dann wälzt sich ein schier endloser Menschenstrom zum Friedhof. Der Imam hat den Tod der fünf zu einer Ästhetik des Sterbens stilisiert, erst leise, beschwörend, dann lauter, am Ende dröhnend: "Nun ist endlich die Zeit gekommen, den Juden die eine, die richtige Antwort zu geben." Der Vorbeter beschwört "die Schar unserer jungen Löwen, die bereit sind, in das Herz des Feindes vorzudringen, nach Tel Aviv, nach Haifa, nach Jerusalem. Kämpft und sterbt im Namen Allahs - gepriesen sei sein Name." Dann zitiert er den Heiligen Koran: "Warum wollt ihr denn nicht um Gottes willen und der Unterdrückten willen kämpfen, jener Männer, Frauen und Kinder willen, die sagen: Herr! Schaff uns deinerseits einen Freund und Helfer. Diejenigen, die gläubig sind, kämpfen um Gottes willen, diejenigen die ungläubig sind, um der Götzen willen." Er schließt mit dem Aufruf: "Kämpft nun gegen die Freunde des Satans. Itbach el Yahud! - Tötet alle Juden!" Der Schlachtruf hallt durch die Moschee, wird durch die Lautsprecher ins Hysterische getrieben, und durch die Mittagshitze ziehen viele tausend Menschen, Kinder, Greise, Halbwüchsige, Familienväter, hinauf zum Friedhof, gelb und grün und schwarz die Flaggen, die Farben von Jassir Arafats Fatah-Jugend, von Hamas und Dschihad el Islami. Sie schießen aus Maschinenpistolen in den Himmel, ein letzter Gruß, für eine Leiche im Pyjama. Dann kommen die schwarzen Blöcke, fünf insgesamt, mit jeweils vierzig Männern, jung und durchtrainiert, um die Stirn das grüne Band des Propheten und vor der Brust Kalaschnikows über gekreuzten Patronengurten. Sie tragen die auf Leichenbahren gebetteten Toten. Die erste Reihe leert die Magazine der Kalaschnikows, lädt nach, dann stürmen alle Blöcke los wie auf Befehl, die Oberkörper ruckartig tänzelnd, während die Leichenträger die Bahren emporstoßen. Ein Toter im Pyjama wippt seinem Grab entgegen. Hebron stöhnt nicht unter der Diktatur des Tötens - Hebron blüht darunter auf. Hebron war schon immer eine Stadt der Frommen gewesen, folglich kontrolliert die Terrororganisation Hamas den palästinensischen Teil der Stadt. Gott ist in Hebron das am meisten mit Blut besudelte Wort. Zwei Tage später auf dem Weg zur Al-Sharyjeh-Schule, einer Einrichtung von Hamas, finanziert aus Saudi-Arabien und dem Iran. An Hauswänden hängen die Bilder junger Männer, vergilbte Bilder und ganz neue. Märtyrer, Tote aus Feuergefechten mit der israelischen Armee, Opfer israelischer Siedler, Suizidbomber, Attentäter, Terroristen. Alle, die sich als Schahid, als Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben, werden verehrt als Gefallene Gottes. Das palästinensische Fernsehen sendet Werbespots über "unsere toten Helden", und die Zeitungen bejubeln den "Befreiungskampf für Palästina". Die Bilder der Toten, blutrot, beinahe kitschig, sie werden zusammengefügt zu einer Galerie des Todes. Scheich Nizzar Ramadan, Schriftsteller, Journalist und eine Art Hamas-Sprecher in Hebron, deutet auf eines dieser Bilder: ein Junge mit Pickeln im Gesicht und dürrem Oberlippenbart. "Ibrahim Iyan hat es geschafft, aus dem Gaza-Streifen nach Alei Sinai einzudringen. Drei Stunden lang hat er der stärksten Armee der Welt getrotzt." In der Al-Sharyjeh-Schule unterrichten bärtige junge Akademiker. Einer begrüßt freundlich den Besucher, spricht über "die Macht der Juden", "die Feinde der Menschheit". Noch immer ist er freundlich. "Sie können das in den Protokollen nachlesen." "In welchen Protokollen?" "In den Protokollen der Weisen von Zion." "Unterrichten Sie Ihre Schüler darin?" "Natürlich." Auf dem Schulhof spielen Kinder. In ihr Lachen mischt sich hin und wieder der trockene Knall aus Sturmgewehren israelischer Soldaten, die in die Luft schießen - oder auf die sieben, acht Jahre alten Kinder, die am Checkpoint, der Hebrons Juden und Palästinenser trennt, Siedler und Soldaten mit Steinen und Molotowcocktails bewerfen. "Safety Passage" steht auf dem Schild am Grenzübergang Erez, wo der Gaza-Streifen beginnt. "Have a nice trip to hell!", grinst der israelische Soldat, "welcome back, if you come back." Der Fahrer aus Gaza-City hat sich geweigert, zu nahe an den Grenzübergang heranzufahren. "Manchmal schießen sie auf uns, einfach so." Er spricht von der Wut, der Angst, dem Hass, vom Verlust der Würde und der Ehre durch die Besatzung des eigenen Landes, von der Aussichtslosigkeit angesichts der jüdischen Siedlungen im Gaza-Streifen, die das verrottete Häusermeer zerschnitten. 6000 jüdische Siedler hielten 1,2 Millionen Palästinenser als Geiseln, erklärt der Fahrer; über Ibrahim Iyan, den Jungen auf dem Foto, spricht er auch. "Der ist nach Alei Sinai gegangen und hat getan, was er getan hat." Wer im späten Herbst der zweiten Intifada nach Gaza reist, der unternimmt eine Reise in die islamistische Finsternis, eine Reise zu einer Gesellschaft im Krieg. Im Krieg mit dem Feind. Im Krieg mit sich selbst. Und irgendwann führt diese Reise nach Rafah, in eine heruntergekommene Kleinstadt im Süden des Gaza-Streifens, dort steht eine Schule. Eine Schule mit Lehrern, die die Jungen das Töten lehren und das Getötetwerden. Dass es in Gaza und im Westjordanland Orte gibt, an denen junge Palästinenser von Lehrern in der Disziplin des Selbstmordattentats unterrichtet werden, ist ein offenes Geheimnis, ebenso, dass sich die politischen Schreibtischtäter von Hamas und des Dschihad el Islami dabei professioneller Lehrkräfte bedienen. "Der Weg zur Befreiung von Al Kuds führt über die Gräber unserer Märtyrer", doziert einer, der als seinen Namen Hassan anbietet. Das Nachtgebet ist vorbei, aus der Entfernung hört man, wie die Gläubigen die Moschee verlassen. Die Schulen des Terrors sind den Moscheen angegliedert, ebenso wie Kranken- und Sozialstationen. Vier Männer sitzen vor den Schulbänken, junge Männer, 27 bis 36 Jahre alt, die Lehrer. Islamistische Internationalisten aus Palästina, Ägypten, Saudi-Arabien, alle mit akademischer Ausbildung, sie alle sprechen englisch, sie alle sind Veteranen der Ausbildungslager von Al-Qaida in der Provinz Nagahar in Afghanistan. Es bereitet ihnen offenbar keine Schwierigkeiten, den hermetisch abgeriegelten Gaza-Streifen fast nach Belieben zu betreten und zu verlassen. Jeder von ihnen zeigt mehrere Pässe her, jordanische, türkische, ägyptische. Sie sprechen darüber, wie leicht es sei, Waffen, Sprengstoffe, Chemikalien, eben alles, was sie brauchten, durch den Gaza-Streifen zu schaffen. Dass dies niemals ohne die stillschweigende Duldung oder Unterstützung staatlicher Dienste funktionieren könnte, bestreiten sie nicht. "Wir können uns auf die Solidarität unserer muslimischen Brüder in allen muslimischen Ländern verlassen. Aus der Armee, der Polizei, aus den Geheimdiensten", sagt Hassan. "Was nicht bedeuten muss, dass die Regierungen der Länder das offiziell dulden." Der Doktor hat seinen Sohn zum heiligen Killer abgerichtet Sie wirken sehr selbstsicher, diese Lehrer des Terrors, und sie wissen genau, warum sie jetzt reden: "Ihr sollt wissen, dass es uns gibt. Sagen Sie den Juden, der Welt, dass es uns immer geben wird, egal, wie lange sie bombardieren, wen immer sie auch töten werden", erklärt Hassan, der Wortführer. Die anderen mustern den Besucher und schweigen. "Wenn unsere Religion angegriffen wird, haben wir das Recht, uns zu verteidigen, auch wenn wir wissen, dass wir selber sterben." Was ein Angriff ist und was nicht, definiert er selbst. "Was wir tun, ist keine Gehirnwäsche, wir brauchen die Jugend unseres Landes nicht zum Märtyrertum zu überreden. Sie wollen dies aus eigenem Willen und wissen, dass ihr Tod kein Opfer ist, sondern eine religiöse Pflicht. Alles, was wir tun, ist, ihnen zu zeigen, wie sie es machen müssen, damit die Aktion ein Erfolg wird. Wir geben unsere Fähigkeiten weiter. Das ist unsere Pflicht." "Haben Sie kein Mitleid mit den Jungen, die Sie in den Tod schicken? Kein Mitleid mit denen, die sie vor ihrem eigenen Tod umbringen?" Hassan lächelt abschätzig. "Wenn die Juden nicht da wären, wo sie sind, würden auch ihre Kinder nicht da sterben, wo sie sterben." Dann ergreift einer seiner Kampfgefährten das Wort: "Sie sollten Mitleid haben mit den palästinensischen Jugendlichen, die hier leben, nicht mit denen, die für Allah sterben. Das ist kein Leben hier in Gaza, in Al Kuds, das ist Sklaverei. Jene, die sterben, geben ein Beispiel für die, die ihnen folgen werden. Ibrahim Iyan war nur einer von vielen. Die palästinensische Jugend ist bereit, sich für Allah und für die Befreiung von Al Kuds zu opfern." Ibrahim Iyan. Der Junge, den sie einen Held nennen im Gaza-Streifen. Was hat es mit ihm auf sich? Man findet Antworten, viele Antworten, und eine ist diese: "Welch unendliches Glück" er brachte, "welche Erfüllung". Sanfte schwarze Augen hat der Mann, der dies spricht, während sein Mund von der Schönheit des Tötens und Sterbens erzählt. "Mein Sohn Ibrahim ist tot", sagt Nizzar Iyan, "nie war ich glücklicher als in dem Moment, da sie kamen und mir sagten: ,Die Juden haben deinen Sohn getötet.'" Der Doktor der Theologie und Dozent der Islamischen Universität Gaza, Nizzar Mohammad Abdul Kader Iyan, hat seinen Sohn verloren. Ein Terrorist, ein Mörder. Der Vater sitzt vor dem Computer, inmitten seiner Bibliothek, die theologischen Bücher sind in Leder gebunden, Goldfäden an den Rändern. Die Klimaanlage bewahrt die edlen Werke vor Schaden. Iyan sitzt an seinem Computer, kurz wirft er einen Blick auf die eingegangenen E-Mails, dann beugt er sich vor, spricht darüber, wie er seinen 17 Jahre alten Sohn Ibrahim zum Töten abgerichtet hat, zum heiligen Killer im Namen Gottes. Iyan studierte an den Universitäten des Sudan, der Al Ahzar in Kairo, den Hochschulen von Amman und Dschidda. 15 Forschungsberichte hat er in wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht, seinen Magister über Das Wesen des Märtyrers im Dschihad im Kampf für den Islam erlangt, den Doktortitel über Die Zukunft des Islams in der modernen Welt. An den Wänden der Bibliothek hängen Bilder der Kaaba in Mekka neben kunstvollen Kalligrafien, Suren aus dem Koran. "Der Islam ist keine Religion des Betens, des Fastens, des Glaubens. Das ist Wissen! Unsere Religion ist ein System, das alle Bereiche des Lebens umfasst, das alles genau reglementiert. Danach leben wir." "Nach diesem Modell hat Ihr Sohn gelebt. Danach ist er gestorben." Iyan lehnt sich zurück, streicht sich mit ruhiger Hand durch den Bart und lächelt. "Ich bin stolz auf meinen Sohn." Iyan sagt diesen Satz mit belehrendem Unterton, er reicht Tee und Süßigkeiten. "Dieses Gefühl ist ein Gefühl des Glücks, wir sind mit dem, was mein Sohn getan hat, unserem Land Palästina und der Al-Aksa-Moschee in Al Kuds ein großes Stück näher gekommen." An einem Abend im Oktober dieses Jahres klettert der 17-jährige Ibrahim, Sohn des Doktor Nizzar Iyan, zusammen mit einem Freund über den elektrischen Zaun, der die jüdische Siedlung Alei Sinai im Norden des Gaza-Streifen umgibt. Ibrahim weiß, dass er sterben wird. Für Al Kuds, das die Juden Yerushalayim nennen. Es ist seine heilige Pflicht. So steht es im Heiligen Koran geschrieben. So hat es Ibrahim in den Monaten vor diesem Abend von seinem Vater gelernt, in der Phase der Vorbereitung, und die anderen Lehrer haben es auch gesagt. "Gottes Fluch komme über die Ungläubigen." Der Junge rennt mit einer Kalaschnikow und mehreren Handgranaten auf die Häuserreihen der Siedlung zu. Um seinen Kopf hat er ein grünes Band geschlungen, auf das ein Vers aus dem Koran gemalt ist. Durch geöffnete Fenster wirft er Handgranaten. Durch das Dröhnen der Explosionen schreckt ein Liebespaar vor einem Hauseingang aus seiner Umarmung auf. Das Letzte, was sie sehen, ist der wild um sich schießende Ibrahim, keuchend und schreiend. Dann dringen die Kugeln in den Körper der 18 Jahre alten Liron Harpaz und in den Körper ihres 20 Jahre alten Freundes Asaf Yitzhaki. Nizzar Iyan erzählt dies alles mit ruhiger Stimme, so als sei er dabei gewesen. Er schildert, dass sein Sohn, nachdem er das junge Paar getötet habe, in ein Siedlerhaus eingedrungen sei, um Geiseln zu nehmen. Iyan zeichnet das Bild eines Jungen mit wachem Geist und reiner Seele, eines Jungen auf dem Weg ins Paradies. Drei Stunden lang liefert sich Ibrahim ein Feuergefecht mit der israelischen Armee, verletzt dabei 15 israelische Soldaten und Siedler schwer, schießt einige zu Krüppeln, bevor er selbst im Kugelhagel israelischer Patrouillen umkommt. "Das war ein Kampf zwischen David und Goliath", sagt der Vater. "Ihr Sohn ist tot. Wo bleibt da der Sieg?" Der Doktor beugt sich vor und zitiert den Koran. "Diejenigen aber, die das diesseitige Leben um den Preis des Jenseits verkaufen, sollen um Gottes willen kämpfen. Und wenn einer um Gottes willen kämpft und er getötet wird, werden wir ihm in Jenseits gewaltigen Lohn geben." Im Paradies, sagt der Doktor, dort, im neuen Zuhause seines Sohnes, seien die Weiden immer grün, und immer zwitscherten Nachtigallen. "Sie glauben an das Paradies?" Der Doktor hantiert mit einem Handy, schnauft kurz und verächtlich. "Ich glaube nicht. Ich weiß! Wir mussten 1948 auswandern, wir wurden von den Juden vertrieben, wir leben nur vorübergehend hier. Ich erzähle meinen Kindern täglich von der Heiligkeit des Landes, von seiner Reinheit und dass es uns von den Juden geraubt wurde. So wie meine Eltern mir das erzählt haben: was wir auf unserem Land angebaut haben, wie unsere Familien zusammengelebt haben. Wir erzählen ihnen, dass der Islam uns verbietet, unser Land einem Ungläubigen zu überlassen, dass wir dafür kämpfen müssen mit unserem Leben für Allah, damit wir unser Land zurückbekommen. Und so werden meine Kinder dies alles eines Tages ihren Kindern erzählen." Er breitet die Trachten seiner Großmutter aus, zeigt deren mit goldenen Ornamenten geschmücktes Kleid aus Askalon, der Stadt, aus der die Familie stammt. Die Ungläubigen haben dort ein Restaurant aus der Moschee gemacht. "Jetzt", klagt Iyan, "verkaufen die Juden dort Alkohol. In der Moschee!" Und dann bringt er einen Fruchtkorb aus geflochtenem Bast. Darin liegen Fruchtsamen. Er lässt die Samen durch die Finger rieseln. "Wissen Sie, was das ist?" "Nein." "Sie haben ja keine Ahnung, worüber wir hier sprechen!" Plötzlich beginnt er zu weinen, stumm zunächst, dann mit einem tiefen Brummen, und während ihm die Tränen in den Bart laufen, schüttelt es den Doktor der Theologie Nizzar Iyan durch, er kann nicht mehr an sich halten, weint vor sich hin, und diese Trauer, die den Doktor da schüttelt, ist nicht die Trauer um den gestorbenen Sohn - Iyan weint um ein Stück Land, das er nie gesehen hat. "Ich habe meinen Sohn dazu erzogen, das zu tun, was er getan hat. Ich habe ihn dazu ermutigt. Das war der Versuch, nach Hause zurückzukommen, Palästina zu befreien, und entweder er kommt an, oder er kommt nicht an. Ich sage meinen Kindern immer wieder: Wir werden nach Askalon zurückkehren, und wenn wir gehen, dann werden wir aus diesem Haus nichts mit zurücknehmen." "Ist es das wert gewesen?" "Ich schwöre beim Leben meiner Kinder, bei der Heiligkeit Palästinas, bei Allah: Ich bin mehr als nur zufrieden mit dem, was Ibrahim getan hat. Ibrahim hat die Grundlagen des Islams verteidigt." "Aber Sie sind sein Vater, es muss Ihnen doch wehtun." "Ich bin ganz ehrlich, ich sage das aus Überzeugung, ich empfinde keine Trauer, ich empfinde Freude, wirkliche Freude, dass das, was wir geglaubt haben, mein Sohn ein Stück weit realisiert hat. Das Leben hat keinen Geschmack, wenn man seine Träume, seine Ziele nicht realisieren kann." So hat er seinen Sohn erzogen. Ibrahim hat zusammen mit seinem Vater immer wieder dessen Magisterarbeit studiert, bis seine Entscheidung gefallen war. An dem Dienstag, als Ibrahim zum Märtyrer werden musste, hat er sich nach Schulschluss von seiner Großmutter verabschiedet, hat dann die 150 Schekel Taschengeld, die sein Vater ihm jede Woche gab, auf seine Brüder verteilt, hat sie umarmt und geküsst und ist dann gegangen. "Meine Freude am Leben ist es nicht, mich gut anzuziehen, gut zu leben", sagt der Doktor, "meine Freude am Leben ist es, in Al Kuds in der Al-Aksa-Moschee zu beten. Mein Sohn hat mit seinem Tod einen guten Beitrag dazu geleistet." "Der Preis für Ihren Traum war sein Tod." "Als meine Tante Ibrahim auf der Leichenbank gesehen hat, hat sie vor Freude getrillert. "Wir haben unser Blut nicht vergessen, wir haben unsere Rache nicht vergessen, wir werden das Blut von Ibrahim nicht vergessen." Hiyam, seine 38 Jahre alte Frau, ist in der Küche beschäftigt, drei ihrer sieben Kinder sind ständig bei ihr. Sie setzt sich neben ihren Mann. Auch sie hat den Freudentriller arabischer Frauen ausgestoßen, als sie hörte, dass ihr Erstgeborener als Märtyrer gestorben war. "Ich schwöre bei Allah, als ich hörte, dass mein Sohn für Allah gestorben ist, war ich glücklich." "Sie waren glücklich?" "Als er auf der Leichenbank lag, habe ich ihn als Bräutigam gesehen, und ich habe alle Leute, die zu uns als Trauergäste nach Hause kamen, nur als Hochzeitsgäste angesehen, die uns zur Hochzeit unseres Sohnes besuchen und uns beglückwünschen." "Hat es wehgetan, als Sie hörten, dass Ihr Sohn tot ist?" Ihre Augen blitzen vor Stolz und Verachtung. "Nein, nein, ich schwöre bei Allah, dass es mir überhaupt nicht wehgetan hat. Sein Tod ist mein ganzes Glück, Ibrahim wollte das, ich habe es ihm nicht verbieten wollen." "Hätten Sie es ihm verbieten können, und hätte er dann auf Sie gehört?" "Ja, natürlich. Er hätte auf mich gehört." "Sie haben es also vorher gewusst?" "Ja, natürlich." "Sie haben es zugelassen?" "Ich hätte mich vor meinem Gott, vor Allah, geschämt, wenn ich es verhindert hätte. Schon vor seiner Geburt habe ich Ibrahim als Opfer für Al Kuds gesehen." "Haben Sie Angst, dass einer Ihrer Söhne den gleichen Weg geht wie Ibrahim?" "Nein, ich werde es ihnen nie verbieten. Im Gegenteil, ich würde sie verachten, wenn sie das nicht tun. Sie wären nicht mehr meine Söhne." Ihr vier Jahre alter Sohn Abdul Kader ist inzwischen in die Bibliothek gekommen und auf ihren Schoß geklettert. Sie streicht ihm zärtlich übers Haar. Ängstlich fixiert er den Besucher. "Yahud? - Jude?", fragt er leise seine Mutter und klammert sich an sie. Hiyam schnalzt nur kurz mit der Zunge und redet dann beruhigend auf ihn ein. "Was ist, wenn Abdul Kader sich eines Tages eine Bombe umschnallt und sie zündet?" "Wenn meine anderen Söhne dasselbe machen, dann werden sie mir Ehre geben." Mohammad, ihr 14-jähriger Sohn, hat das Gespräch belauscht, ein Junge von kräftiger Gestalt. Manchmal in den letzten Minuten war ihm anzumerken, wie schwer es ihm fiel, Wut und Hass zu unterdrücken. "Die Juden töten kleine Kinder", schreit er jetzt, "wie können Sie verlangen, dass wir friedlich mit ihnen zusammenleben?" Und dann klagt er über den Tod der sechs Monate alten Iman Hoja, die von israelischen Soldaten getötet wurde, und wie er das sagt, ist es eine Totenklage, eine, die für das Sterben des Babys Iman Hoja eine Antwort verlangt. Er sagt: "Die richtige Antwort!" "Welches ist die richtige Antwort?" Mohammad schweigt. Seine Augen starren an die Wand. "Hat dein Bruder Ibrahim die richtige Antwort gegeben?" Der Junge schweigt. "Wirst du den Juden diese eine richtige Antwort geben?" Mohammad erhebt sich wortlos, baut seine massige Gestalt vor dem Besucher auf. Dann zieht er kommentarlos sein T-Shirt aus und dreht sich ganz langsam um die eigene Achse. Brust und Rücken sind voller Narben und Operationswunden. Einschusslöcher, Austrittwunden. Fünf insgesamt. "Ich kämpfe seit einem Jahr gegen die Juden. In Montar, in Nezzarim, in Rafah. Ich habe nur Steine oder Molotowcocktails. Sie haben Panzer, Hubschrauber, Maschinengewehre." Mohammad fährt mit dem Finger über die Narben. "Das hat es mir gebracht. Sie wollten mich töten, ich habe keinen von ihnen getötet." In der Al-Aula-Moschee in Chan Junis drängen sich die Trauernden um die Leiche des 17 Jahre alt gewordenen Mahmud. Sie klagen und schreien und weinen. Immer wieder trommeln sie mit den Fäusten auf die Brust, spreizen die Finger zu Krallen, so als wollten sie sich vor Schmerz über den Tod des Freundes das Herz aus der Brust reißen. Der Tote ist in das grüne Banner des Propheten geschlungen. Hunderte schieben gegeneinander, um an den Leichnam zu gelangen, ihn ein letztes Mal zu küssen. "Arafat selbst hat Mahmud getötet", sagt der Begleiter, der Hamid genannt werden will, bei diesem Gang in die Hamas-Moschee. Hamid hat angekündigt, in den nächsten Nächten erneut Kontakte zu Mitgliedern des militärischen Arms von Hamas herzustellen. "Der Tod von Mahmud wird Hamas noch mehr Zulauf bringen, jeder Märtyrer produziert durch seinen Tod neue Kandidaten." An diesem Morgen ist Mahmud nach einem sieben Tage dauernden Todeskampf im Krankenhaus gestorben. Sein Sterben beginnt genau einen Tag, nachdem die USA begannen, Afghanistan zu bombardieren. An diesem Tag brennt Gaza am Abend. Mahmud war mit Tausenden Studenten der Universitäten Gazas auf die Straße gegangen. Neben den Fahnen von Arafats Fatah-Jugend, den von Hamas und dem Dschihad el Islami wurden Tausende Plakatbilder von Osama bin Laden in die Höhe gehalten. Er ist ihr Held, ihre Hoffnung. Arafats Polizei drängt die Fernsehleute von der Menschenmenge weg. Es dürfen im Westen keine Bilder von jubelnden Palästinensern mit Osama-Plakaten zu sehen sein. Dann wird Feuerbefehl gegeben. Arafats Polizei schießt die jungen Demonstranten gnadenlos zusammen. Auf den Straßen liegen Tote und Verletzte. Einer von ihnen ist Mahmud. Die wütenden Demonstranten brennen Polizeistationen Arafats nieder, skandieren "Arafat, Lakai der Juden" und "Tod allen Kollaborateuren." Lehrer zeigen den Jungen, wie man Pistolen zusammensetzt Hamid, Student der Islamischen Universität, küsst Mahmud ein letztes Mal. Er kniet nieder und lauscht der Stimme des Imams. Der Prediger verdammt Arafats Politik, das Zögern und Zaudern, er fordert: "Im Kampf gegen die Juden muss jedes Mittel eingesetzt werden." Wer das nicht billige und mittrage, sei ein Verräter an der heiligen palästinensichen Sache. Denen sei Strafe gewiss. "Und da sind die, die gegen Allah und seine Sendboten kämpfen und Fäulnis und Verderbtheit über das Land verbreiten. Dann wird es ihr Ende sein, sie werden getötet oder gekreuzigt, oder ihre Hände und Arme werden abgeschnitten, oder sie werden aus dem Land vertrieben." Die Trauernden murmeln, sie pflichten ihm bei. Der Trauerzug bewegt sich zum Friedhof. "Sogar seine eigene Fatah-Jugend arbeitet mit uns zusammen", brüllt Hamid und versucht, das Knattern der Maschinenpistolen zu übertönen. Im Hinterhof eines Hauses in Rafah, dem Flüchtlingslager im Süden des Gaza-Streifens, sitzen sieben junge Männer beisammen. Ein Haus weiter beginnt ein endloses Trümmerfeld, drei Tage zuvor waren es noch knapp 20 Häuser, bevor israelische Panzer am frühen Morgen die Gebäude platt gewalzt haben. "Einfach so", behauptet einer aus der Runde und zeigt auf einen Panzer, wenige Meter entfernt. Die sieben Studenten sprechen gelassen über ihren "Befreiungskampf". "Die Juden haben Panzer, Flugzeuge, Atomwaffen. Wir haben nichts. Das Einzige, was wir haben, sind unsere Märtyrer. Wir, die Märtyrer, sind unsere Atombomben." Wenn sie lachen, dann lachen sie wütend auf, reden durcheinander, und jeder für sich ruft die Namen und das Alter palästinensischer Opfer. "Ganz Palästina ist wie eine Moschee, klar und rein. Durch die Juden ist es beschmutzt worden." "Wann wird dieser Konflikt beendet sein?" "Dann, wenn das letzte Stück Land von den Juden befreit ist. Dafür kämpfen wir. Das müssen wir, wir können nicht anders. Der Koran schreibt mir zwingend vor, dass ich als Muslim mein Recht niemals einem Ungläubigen überlassen darf." "Wie wollt ihr diesen Kampf gewinnen?" Mit der Gelassenheit dessen, den nichts erschüttern kann, antwortet einer: "Wir lieben den Tod so sehr, wie die Juden das Leben lieben." "Aber ihr tötet Unschuldige. Frauen, Kinder." Die eben noch offenen Gesichter werden verschlossen. Einer sagt nur: "Die Juden töten unsere Kinder, wir töten ihre." Ein anderer fragt, ob der Besucher an den Koran glaube. Auf die verneinende Antwort erklärt er: "Dann ist das Gespräch hier zu Ende." Es ist Abend, das Gebet vorbei, die meisten Gläubigen haben die Al-Aula-Moschee in Rafah verlassen. Wer in der Moschee betet, steht dem Dschihad el Islami nahe. Die meisten, die hierher kommen, sehen sich als Sympathisanten oder Mitglieder von Hamas und Dschihad. Hamid hat das Treffen organisiert, zwei etwa 30 Jahre alte Männer mit dunklen Bärten betreten den Gebetsraum. Sie grüßen freundlich, bitten um Verständnis und fordern auf, alle Taschen zu entleeren, alles herzuzeigen, was man bei sich trägt. Sie beschäftigen sich lange mit den Handys, kontrollieren das Aufnahmegerät. Die Telefone müssen zurückbleiben. "Der Mossad", entschuldigt sich einer beiläufig, "schickt manchmal als Journalisten getarnte Agenten hierher." Dann tasten sie genau den ganzen Körper ab und fordern auf mitzukommen. "Was passiert in solchen Fällen mit den getarnten Agenten der Israelis?" Die beiden bleiben stehen. "Wir schicken sie zurück", antwortet der eine, "aber nie ganz." Draußen vor der Moschee stehen zwei Polizisten, sie begrüßen einander, umarmen sich, plaudern. Kurz mustern sie den Fremden, bieten Zigaretten an. Es ist dunkel, doch die Männer im Wagen bestehen darauf, dass dem Besucher die Augen verbunden werden. Dann fahren sie eine halbe Stunde lang kreuz und quer durch Palästinas Nacht. Der Weg führt über Geröllhalden zu einem Haus. Die Augenbinde darf jetzt gelöst werden. Ein großer Raum, geschmückt mit grünen Fahnen, Koransuren und den Bildern von Märtyrern. Eine Bildergalerie toter Jungen. An der Wand stehen Kisten. Darin Maschinenpistolen, in Ölpapier sorgsam verpackt. Kalaschnikows, Galil-Sturmgewehre und solche made in Germany: Heckler und Koch MP 5. "Wir beantworten nicht alles", heißt es auf die Frage, wie und woher man die MP 5 bezogen habe. Daneben Handgranaten und Mörsergeschosse. Etwas entfernt, in einer Ecke, kauern vier Jungen, 14 und 15 Jahre alt. Sie haben den Koran studiert, jetzt hören sie zu, wie ein etwa 50-jähriger Mann mit grau meliertem Bart erklärt, was man von ihnen verlangt in den Tagen nach dieser Nacht. Dass ihre Mission sie ins Paradies führen werde. Dass sie Angst haben könnten und dass das natürlich sei, auch dass es Momente des Zweifels geben werde, natürlich, nur natürlich. "Aber", und nun wird er eindringlich, "was ihr tut, das werdet ihr für euer Land, euer Volk und für Allah vollbringen." Die Jungen hören zu, nicken eifrig, stellen Fragen, wann es losgehe, wohin, wie. Der Graumelierte wehrt die Neugierde ab, milde lächelnd. Sein Lehrauftrag umfasst die spirituelle Vorbereitung, um nichts anderes darf es hier gehen. Den Jungen ist die Ungeduld anzusehen. In der Mitte des Raumes sitzen fünf weitere Jungen. Sie setzen zerlegte Maschinenpistolen wieder zusammen. Beaufsichtigt werden sie von vier Männern, zwei Palästinensern, einem Ägypter, einem Saudi. Sie sind aus Afghanistan zurückgekehrt. Um zu lehren. Die vier geben ihren Zöglingen Anweisungen, zeigen, wie die Teile der Maschinenpistolen zusammenpassen, korrigieren Fehler, erklären, wie Handgranaten zu handhaben seien, wie man militärische Absperrungen umgehen könne und wie man sich bei Kontrollen zu verhalten habe. Sie mahnen, der Feind sei darin geschult, sie zu enttarnen, an ihrer Körpersprache, ihrer Gestik, ihrem Gesichtsausdruck. Die Schüler hören angespannt zu, sichtlich stolz, als Männer ernst genommen zu werden, als Kämpfer. Munter fragen sie nach, aus welcher Distanz sie zu schießen haben, fragen nach Streubreite und Rückstoßwirkung, wollen wissen, wann ihr Tag komme, wann genau. Die Lehrer nehmen sich Zeit, beantworten geduldig alle Fragen. Schließlich wenden sie sich dem Besucher zu, distanziert, aber freundlich. Sie scheinen keine Angst zu haben, erkannt zu werden. "Jeder hier in Rafah weiß, was wir tun, wer wir sind", sagt einer der Palästinenser. "Auch Arafats Polizei." Dann führt er den Besucher in den nächsten Raum. Darin steht ein Tisch, über dem eine grüne Fahne hängt, geschmückt mit dem Vers einer Sure aus dem Koran. Daneben eine Karte von Filistine, wie die Palästinenser Palästina nenne. Filistine vom Meer bis zum Fluss. "In einem Raum wie diesem werden die Märtyrer an jenem Abend, bevor sie losgehen, auf Video aufgenommen", erklärt der Palästinenser. Er deutet auf den Boden. Dort liegen, ordentlich verteilt auf mehrere Haufen, scharfkantige Metallsplitter, Nägel, Schrauben, Muttern. "Das, in einen Gürtel mit Sprengstoff gefüllt, ist die Sprache, die die Juden verstehen." "Ich bin Lehrer", sagt der Palästinenser und lacht kurz auf, "nein, ich bin tatsächlich Lehrer, ich unterrichte auch in einer richtigen Schule." Der Lehrer geht zurück in den Unterrichtsraum, zum Seminar des Terrors. Die vier Schüler haben die Kalaschnikows zusammengebaut. Jetzt wendet sich der Lehrer seiner Gruppe wieder zu, gibt Anweisungen und wechselt nach einer Weile den Ton, kippt ins Salbungsvolle ab. Die Schüler kleben an seinen Lippen. Hamid übersetzt leise, was der Lehrer spricht; und was der zu erzählen weiß, nennt sich "Reinheit des Tötens, Erhabenheit des Sterbens, Klarheit und Schönheit der Momente, die vor dem einen, dem letzten Moment kommen, wenn du die Leine an deinem Bauchgürtel ziehst, hoffst, dass alles gut geht und sechs Kilogramm Sprengstoff, Nägel, scharfkantige Metallsplitter und Schrauben explodieren, dich selbst zerfetzen und so viele Feinde des einen Gottes, Allah, gepriesen sei der Name des Allmächtigen, des Barmherzigen, in den Tod geschickt werden. Und dann, dann endlich gehst du ein ins Paradies."aus: DIE Zeit, 13.12.2001