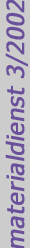Es war der Tag, an dem das Leben noch einmal begann
Renate Harpprecht erinnert sich an die Befreiung aus dem KZ Bergen-Belsen am 15. April 1945
Am 15. April 1945, es war gegen Mittag, rückten britische Truppen in das KZ Bergen-Belsen ein. Unter den befreiten Lagerinsassen waren Renate Lasker-Harpprecht und ihre Schwester Anita Lasker-Walfisch, Cellistin im Mädchen-Orchester im KZ Auschwitz. Wir dokumentieren die Erinnerungen von Renate Harpprecht an die Verschleppung aus Auschwitz nach Westen im Oktober 1944, ihre Beschreibung der Gefangenschaft unter den Nazi-Schergen, ihre Reflexionen über die junge Bundesrepublik, die Rückkehr jüdischen Lebens nach Deutschland und das "Signal der Hoffnung" - die Eröffnung des jüdischen Museums in Berlin im vorigen Herbst. Die Journalistin Renate Harpprecht hat ihre Gedanken am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, in einer Rede im Saarländischen Landtag zusammengefasst. Was uns rettet, ist die Liebe zum Leben Mein Tag der Befreiung war der 15. April 1945. Damals, erst recht nicht bei der Abreise von Auschwitz hätte ich mir träumen lassen, dass ich Jahrzehnte später in einem deutschen Parlament aus Anlass eines offiziellen Auschwitz-Gedenktages reden würde. Wir hatten längst keine Kraft mehr, zu träumen. Ich selber war am 27. Januar, dem Tag der Befreiung durch die Sowjetarmee, nicht mehr im Vernichtungslager. Ich hatte mich, Ende Oktober 1944, auf den ersten Transport geschmuggelt, der das Lager Richtung Westen verließ - um mit meiner Schwester Anita zusammenzubleiben, der Cellistin von Auschwitz, die mit den anderen Mitgliedern des Lager-Orchesters evakuiert werden sollte. Es ging das Gerücht um, wir würden in ein "Erholungslager" befördert. Die Wirklichkeit war anders. Aber so ungewiss das Schicksal auch war, dem wir entgegenrollten: Wir hatten durch eine Kette von Wundern überlebt - nun wollten wir, da sich eine Chance bot, fort, nur fort aus der Hölle auf Erden, aus dem Todesschatten der Gaskammern, fort von der fetten, schwarzen Wolke mit dem penetranten Geruch verbrannten Fleisches über den Krematorien. Wir wussten nicht, dass wir nur von einer Hölle in die andere verlegt wurden: nach Bergen-Belsen, das kein Vernichtungslager war. Dort krepierten Zehntausende auf, wenn man so will, "natürlichem" Wege: Sie verhungerten, sie verdursteten, sie erfroren, sie wurden - ohne Medikamente und den Luxus ärztlicher Versorgung - von den Seuchen dahingerafft, oder sie gaben eines Tages, eines Nachts einfach ihrer im wörtlichen Sinne tödlichen Erschöpfung nach. Sie starben, weil sie nicht mehr leben konnten und nicht mehr leben wollten. Ein Leben war es ohnehin nicht: sondern das Vegetieren in einer trostlosen Dunkelheit, in die selten ein Hoffnungsschimmer vordrang. Wir waren von der Welt abgeschnitten. Keine Nachricht erreichte uns, höchstens diese und jene Spekulation über den Fortgang des Krieges. Wir fühlten uns nicht nur von der Welt, sondern oft genug von Gott verlassen. Nein, wir ahnten nicht, dass am 27. Januar die Russen, die doch wahrhaftig Schreckliches gewohnt waren, voller Entsetzen durch die Lagerstädte Auschwitz und Birkenau liefen, in denen die SS ihre Todesfabriken, die Gaskammern, gesprengt hatte, um die Spuren des Millionenmordes zu beseitigen. Das gelang nur unvollkommen. Die Sowjetsoldaten fanden bloß noch einige hundert zu Skeletten abgemagerte Menschen vor. Die anderen Überlebenden waren auf die Todesmärsche nach Westen gehetzt worden, die für Tausende der Marsch in den Tod waren. Wer nicht weiterkonnte, wurde erschossen oder erschlagen. Meine Schwester und ich wussten an jenem 27. Januar in Bergen-Belsen nicht einmal, dass man den 27. Januar schrieb. Der Gedanke, dass jener Tag in die Geschichtsbücher eingeschrieben würde, war uns fern. Wir hätten vermutlich nur dumpf in die Luft gestarrt, hätte uns jemand gesagt, dass ein halbes Jahrhundert später der Präsident Deutschlands den Befreiungstag von Auschwitz zu einem offiziellen Gedenktag erheben würde. Wir waren mit der Mühsal des Überlebens von Tag zu Tag beschäftigt, vor allem mit den Versuchen, einen Kanten Brot zu erkämpfen. Meine Schwester lag damals mit hohem Fieber in der Baracke. Sie durfte nicht sterben. Wir wussten beide, dass die eine ohne die andere nicht überleben konnte. Erloschene Heimat Wenn wir an eine Zukunft zu denken wagten, dann dachten wir - verzeihen Sie das offene Wort - nicht mehr an Deutschland. Wir wussten nicht, dass unsere Heimatstadt Breslau für Deutschland ohnedies verloren war und künftig Wroclaw heißen würde. Wir hatten keine Nachricht über den Tod unserer Eltern (unser Vater war Rechtsanwalt und Notar, unsere Mutter Musikerin). Aber wir wussten aus den letzten Zeilen unseres Vaters, die er nach draußen schmuggeln konnte, dass sie dem Tode nahe waren. Erst viele Jahre später erlangten wir die Gewissheit, dass sie nach ihrer Deportation in dem Lager Isbica nahe Lublin ermordet wurden, nachdem sie - wie dort üblich - ihre eigenen Gräber hatten graben müssen. Ich will hier nicht verschweigen, dass mir nach einer Fernsehdiskussion, in der ich vom Ende meiner Eltern berichtet hatte, ein ehemaliger SS-Offizier - nun Bahnbeamter im Ruhestand - mit einer Klage wegen Verleumdung gedroht und zynisch gefordert hatte, ich möge Beweise für den gewaltsamen Tod des Vaters und der Mutter vorlegen. Sein Anwalt schickte eine Rechnung über die entstandenen Kosten gleich mit. Beide wurden zu einer Bagatellstrafe verurteilt, doch vom Publikum im Gerichtssaal mit Beifall gefeiert. Nein, wir dachten, wenn wir ans Überleben - an Leben - dachten, nicht an Deutschland. Es war als Heimat erloschen. Wir dachten an Amerika, wo ein Bruder unseres Vaters zu Hause war, an Palästina, wo unsere älteste Schwester, die noch vor dem Ausbruch des Krieges nach England entkommen war, mit ihren zionistischen Freunden einen Kibbuz gründen wollte (sie starb dort bei der Geburt ihres zweiten Kindes). Wir dachten an England, an Frankreich, wo vielleicht der eine oder andere der Kriegsgefangenen, denen wir zur Flucht verhalfen, zu finden sein würde. Im Frühjahr 1945 kündigte sich endlich durch das Grollen der Geschütze, aber deutlicher noch durch die Unruhe der Wachmannschaften das Nahen der Front an. Jahrzehnte später berichtete ich in einer Fernsehsendung: Der Monat April '45 war ungewöhnlich heiß. Daran erinnere ich mich sehr genau: an die drückende Hitze in der Lüneburger Heide und den süßlichen Gestank von Tausenden verwesender Leichen. Ich brauche nur die Augen zu schließen, und auch jetzt, nach über 50 Jahren, steigt mir der widerliche Gestank in die Nase. An viele Dinge, die am 15. April geschahen, kann ich mich heute nur ungenau entsinnen, aber Einzelheiten sind mir präsent: Am Morgen hatte ich meine Schwester der Obhut einer Freundin anvertraut, um etwas Trinkwasser aufzutreiben. Seit Tagen gab es kein Brot mehr zu essen. Die Suppe, die manchmal verteilt wurde, war eine trübe Brühe, auf der Rübenschalen schwammen. Nur wer noch einigermaßen bei Kräften war, konnte eine Schüssel davon ergattern. Man stritt, man kämpfte bei der Essensverteilung um jeden Tropfen. Ich fand einen rostigen Eimer und ging ans Lagertor. Ein SS-Mann, sein Name ist mir unvergesslich - er hieß Kasernitzki - stand Wache am Tor und versuchte nicht einmal, mich aufzuhalten, als ich zum einzigen noch funktionierenden Wasserhahn lief, der sich in der Nähe der Verwaltungsgebäude des Lagers befand. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Das deutsche Wachpersonal war verschwunden. Keiner hielt mich an. Ich füllte meinen Eimer und ging durchs Tor ins Lager zurück, als eine Horde von halb verdursteten Häftlingen sich auf mich stürzte, um mir den Eimer wegzureißen. Er kippte um, und das kostbare Wasser versickerte im Staub der Lagerstraße. Ich kehrte mit leeren Händen in die Baracke zurück. Ich half meiner Schwester, von ihrer Schlafpritsche herunterzusteigen, und führte sie ins Freie. Dort setzten wir uns auf die Erde und lehnten uns an die Barackenwand - vor uns und hinter uns lagen Leichen. Einige Tage zuvor hatte die SS ein Kommando von einigen Häftlingen zusammengetrommelt, die noch aufrecht stehen konnten. Wir sollten die Leichen in große Gruben schleppen. Man hatte uns Schnüre gegeben, mit denen wir die Arme der Toten zusammenbinden sollten, um sie dann quer durchs Lager in die Grube zu zerren. Doch dieses Unterfangen wurde bald aufgegeben. Wir waren zu schwach und konnten an einem Tag nie mehr als etwa fünfzig Leichen wegschleppen. Es war Mittag geworden. Seit Tagen hörten wir leises Rumpeln von schweren Geschützen, doch wir hatten keine Ahnung, was draußen, jenseits des Lagers, vor sich ging. Wer schoss? Waren es die Deutschen? Waren es die Alliierten? Inzwischen war das leise Rumoren einem unverkennbaren Geräusch gewichen - dem Rasseln von Panzerketten. Im Lager war es totenstill geworden - und in diese Stille drang auf einmal eine englische Stimme: "This is the British Army. Please remain calm. We have come to liberate you. Don't leave the camp und don't worry. You are free." Und dann rollten die ersten Tanks ins Lager. Wir schauten stumm auf unsere Befreier. Zum Jubeln hatten wir keine Kraft. Es war vier Uhr nachmittags an diesem sonnigen 15. April des Jahres 1945. Das war mein Befreiungstag, den ich Jahr für Jahr wenigstens mit einer Minute der Besinnung feiere. Es war der Tag, an dem das Leben noch einmal begann. Der Anfang war kein Rausch. Meine Schwester schrieb: "Jahrelang waren wir durch alle Extreme von Emotionen gezerrt worden: Elend, Entbehrungen, Erniedrigung, Verzweiflung, Angst, Hunger, Hass. Es gibt eine Grenze... Unsere Erfahrungen lagen jenseits dessen, was einem Menschen in einer langen Lebensspanne zugemutet wird. Und plötzlich war alles zu ende. Wir waren befreit. Seit Jahren hatten wir für diesen Augenblick gelebt, wenn man Glück hatte - und lebte . . . Es war schwer zu fassen. Ich war neunzehn Jahre alt und fühlte mich wie neunzig." Hunger, Erniedrigung, Todesangst Ich selber war zwei Jahre älter, aber wir hatten in jenen Tagen kein Alter. Wir waren auf eine gespenstische Weise alterslos. Das Bewusstsein der Jahre, die unsere Jugend sein sollten, gewannen wir nur langsam zurück, als aus den kaum mehr lebenden Halbleichen, die wir waren, nach und nach wieder menschliche Wesen wurden: als aus den "Untermenschen", die die Schergen der angeblichen Herrenrasse in uns sehen wollten - und zu denen sie uns durch Hunger, Durst, Schmutz, Erniedrigung und tägliche Todesangst in gewisser Weise gemacht hatten - wieder Geschöpfe von menschlicher Würde werden konnten. Die britischen Soldaten befahlen den gefangenen Wachmannschaften, unseren Dienst zu übernehmen und die Leichenberge - es waren zehntausend Tote unter fünfzigtausend Häftlingen - in die Gruben zu schaffen. Die arrogante Soldateska von gestern fing nach einigen Tagen an, uns, den Häftlingen, auf merkwürdige Weise zu gleichen. So rasch ging das. So rasch geht das noch immer, muss hier hinzugefügt werden, wenn Menschen durch eine übermächtige Gewalt ihrer Würde beraubt werden. Vermutlich waren die einstigen Herren über unser Leben und unseren Tod zu primitiv, um diese Lektion zu begreifen. Auch von ihnen starben viele an Typhus, dem sie nun ungeschützt preisgegeben waren. Die Briten verurteilten die anderen einige Monate später in einem fairen Prozess, die meisten zum Tode. Brandts Kniefall in Warschau Es sollten viele Jahre ins deutsche Land gehen, bis sich deutsche Staatsanwälte und deutsche Richter entschlossen, seriöse Verfahren gegen die Verbrecher von Auschwitz, von Majdanek, von Treblinka zu eröffnen. Der Auschwitz-Prozess in Frankfurt wäre vermutlich ohne den eisernen Willen des Generalstaatsanwalts Bauer, der jüdischer Herkunft war, niemals zustande gekommen. Es war mir, obwohl ich mich von Deutschland fern hielt, nicht entgangen, dass die Mehrzahl der Richter in der Bundesrepublik schon der Justiz des Dritten Reiches gedient hatten. Nur gegen einen der Blutrichter, die auch zehntausende nichtjüdischer Deutscher unters Fallbeil gebracht hatten, ist jemals Anklage erhoben worden. Damals war ein großer Teil der Deutschen nicht bereit, der so genannten Vergangenheit ins Auge zu sehen: vermutlich zu abgestumpft durch den Krieg, die Bombennächte, die Gefangenschaft, die Vertreibung, den Kampf ums tägliche Brot in einer Welt des Mangels und der Trümmer, seelisch und moralisch gelähmt von der Nähe des Grauens, von den erlittenen Verlusten, vor allem aber von der Verdrängung eigener Schuld - und manchmal durch eine entnervende, würdelose Neigung zum Mitleid mit sich selber, das ihnen nicht erlaubte, das Leid der anderen zu sehen. Bis zu einem gewissen Grade gebot auch uns, den Opfern, die Scheu, nein, die Angst vor dem Entsetzen des Gestern ein hilfloses Schweigen. Auch uns - oder uns erst recht - lähmte die Neigung zum Verdrängen, das vielleicht notwendig war, um uns den Mut zum Leben zu lassen. Deutschland erlebte den Anfang einer inneren Befreiung wohl erst mit dem Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal im Ghetto von Warschau: dieser mutigsten deutschen Tat des Nachkriegs, mit der ein untadeliger Mann des Widerstandes gegen die Diktatur - die Diktatur der Nazis und der Kommunisten - für sein ganzes Volk die Schuld und die Bitte um Vergebung auf sich nahm. Diese große Geste war auch für mich in meiner Beziehung zu Deutschland und den Deutschen so etwas wie eine Befreiung. Erst an Weihnachten 1945 war es mir und meiner Schwester gelungen, Bergen-Belsen und Deutschland mit Hilfe eines englischen Offiziers heimlich zu verlassen. Kein Land wollte uns, den einstigen deutschen Bürgern, die nun staatenlos waren, die Einreise gewähren. Wir gelangten zunächst nach Brüssel. Endlich, einige Monate später, wurden wir in England aufgenommen. Meine Schwester setzte unverzüglich ihre musikalische Ausbildung fort. Ich begann im deutschen Dienst der BBC zu arbeiten, zuerst als Sekretärin, dann als Sprecherin und schließlich als Moderatorin eigener Programme. Nach Deutschland wollte ich nie mehr zurückkehren. Es kam anders. Seit über 40 Jahren bin ich nun mit einem Deutschen verheiratet. Mit meinem Mann lebte ich einige Zeit in Köln und wirkte an Programmen des WDR mit. Später wohnten wir mehrere Jahre im Umkreis von Stuttgart, von Frankfurt und während der Kanzlerschaft Willy Brandts in Bonn. Aus Gründen des Prinzips forderte ich meinen deutschen Pass zurück, der mir von den Nazis aberkannt worden war, da ich nicht würdig war, eine Deutsche zu sein. Dafür musste die Vorstrafe gelöscht werden, die ein Breslauer Gericht wegen unserer Hilfe für französische Kriegsgefangene und wegen unseres Versuchs der illegalen Ausreise über uns verhängt hatte - in einem Verfahren, das eine Farce war. Die bundesdeutschen Richter ließen sich Zeit. Wie hatte ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der als Feldrichter noch nach der Kapitulation deutsche Soldaten in den Tod geschickt hatte, so unübertrefflich formuliert? "Was gestern Recht war", rief er, "kann heute nicht Unrecht sein . . ." Man schien nicht sicher zu sein, ob ich nicht doch als Kriminelle betrachtet werden müsse. Der Zorn der deutschen Freunde, die ich unterdessen gewonnen hatte, konnte den vorschriftsmäßigen Gang der Dinge nicht beschleunigen. Lange Jahre lebten wir in Amerika, wo ich Filme für das ZDF produzierte. Schließlich ließen sich mein Mann und ich in Frankreich nieder. Dort wurden wir am Fernsehen Zeuge, wie Bundespräsident von Weizsäcker am 8. Mai 1985 zum vierzigsten Jahrestag der Kapitulation das erlösende Wort sprach, dass damals in Wahrheit auch Deutschland befreit worden sei: das "andere" Deutschland, von dem wir hoffen, dass es nun für immer das einzige sein würde. Meinen deutschen Pass behielt ich. Aber es bereitete mir eine tiefe Genugtuung, dass er eines Tages - wie mein französischer Pass - zu einem europäischen Pass wurde. Es verging ein halbes Jahrhundert, bis ich den Mut fand, Auschwitz aufzusuchen, eingeladen von einer Delegation der israelischen Botschaft in Berlin. Die schrecklichsten Bilder des Grauens berührten mich nur von fern: die Berge der Kinderschuhe, die Berge von Haar, das man den Häftlingen - und natürlich auch uns - abgeschnitten hatte. Ich sah das nur durch einen Schleier: es war zu obszön. Es war jenseits dessen, was die menschliche Seele akzeptieren kann. Es wurde mir schwerer, eine Nachbildung der Baracken zu besichtigen, in denen wir gehaust hatten: die Verschläge, in denen wir wie die Sardinen zusammengepfercht lagen, auf schmutzigem, halbfaulem Stroh. Im Übrigen registrierten wir, dass Teilen des Lagers der Zerfall droht. Es wäre an der Bundesrepublik Deutschland, sich für die Erhaltung zu engagieren: Denn Auschwitz und die anderen Todeslager sind die eigentlichen Gedenkstätten für die Millionen Toten, wenigstens so wichtig, doch in Wahrheit wichtiger als die Gedenkstätte, die nun im Herzen von Berlin angelegt wird. Der Augenblick der Erschütterung war eine private schlichte Zeremonie, als für unsere ermordeten Angehörigen Kaddish gesagt wurde, das jüdische Totengebet. Ich atmete auf, als wir am Abend nach Krakau zurückkehrten, eine schöne, unversehrte Stadt, die dank der Universität mit so jungem Leben erfüllt war. Leben. Unterdessen ist geschehen, was ich niemals mehr für möglich gehalten hatte: es gibt wieder jüdisches Leben in Deutschland. Dank der Zuwanderung aus Russland und aus anderen Staaten des befreiten Osteuropa, für die Kanzler Kohl bei der Wiedervereinigung die Grenzschranken geöffnet hat, sind die Gemeinden, die zum Aussterben verurteilt zu sein schienen, wieder auf mehr als hunderttausend Menschen angewachsen. Das ist nur ein Fünftel der jüdischen Bürger, die 1933 in Deutschland gezählt wurden - es waren auch damals nur ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Aber dass es sie gibt, dass auch die jungen Menschen bleiben wollen - und nicht allesamt "auf gepackten Koffern" sitzen -, das ist fast schon ein Wunder. Viele dieser Einwanderer sind, in der atheistischen Sowjetunion aufgewachsen, von den Traditionen, von der Kultur, vom Glauben des Judentums kaum berührt. Sie wissen auch so gut wie nichts vom Geist des deutschen Judentums, der sich im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert in einer Symbiose mit dem Geist der Aufklärung geformt hatte. Doch eine Kennerin der Verhältnisse vom Rang der Publizistin Rahel Salamander berichtet, dass sich das Interesse am Erbe der liberalen jüdischen Reformbewegung, die einst von den deutschen Gemeinden aus in die Welt ging (vor allem nach Amerika), wieder zu regen beginnt. Botschaft des Lebens Man mag die feierliche Eröffnung des jüdischen Museums in Berlin im September des vergangenen Jahres, zwei Tage vor der Erschütterung durch den islamistischen Terror, eine Stunde der Wende nennen. Sie war gewiss eines der wichtigen Ereignisse in der kurzen Geschichte des wiedervereinigten Deutschland - und sie war ein Signal der Hoffnung. Sie wurde zu Recht als ein Fest gefeiert. Die Architektur von Daniel Libeskind gedenkt auf geniale Weise des Holocaust, aber das eigentliche Museum in den oberen Geschossen vermittelt eine Botschaft des Lebens. So wollte es der amerikanisch-deutsche Jude Michael Blumenthal, einst Finanzminister des Präsidenten Jimmy Carter, der den Charakter der permanenten Ausstellung mit Zeugnissen aus den zweitausend Jahren jüdischer Präsenz im Herzland Europas geprägt hat. Nicht nur Verfolgung, Leiden und Tod - von denen nichts unterschlagen ist -, sondern Zeugnisse jüdischen Alltags, jüdischer Vitalität, jüdischer Produktivität, jüdischen Dienstes am Geist und an den Künsten sind das dominierende Element, das unterdessen mehr als dreihunderttausend Besuchern begegnete - und der Strom des Interesses reißt nicht ab. Die Botschaft des Lebens mag die Bereitschaft zu einer guten Nachbarschaft zwischen der jüdischen Minderheit und der nichtjüdischen Mehrheit stärken, die tolerante Koexistenz, die gegenseitige Anregung, das geistige Geben und Nehmen. Die Ehrfurcht vor dem Leben, um das schöne Wort Albert Schweitzers zu zitieren, ist der Schlüssel. Wo immer sie bedroht ist - in jeder Gewalttat gegen Fremde, in jeder aggressiven Regung der barbarischen Glatzen, in jedem Hetzwort der getarnten Aufwiegler aus den rechtsradikalen Sekten und Parteien, in jedem Ausbruch antisemitischer Ressentiments - überall, wo sich der Aufstand gegen unsere Zivilisation wieder ankündigen will, ist der Hass gegen das Leben selbst am Werk. Die Deutschen haben es erfahren: der Tod, den die nazistische Krankheit über die Völker und vor allem über die Juden brachte, strafte das eigene Land hart genug. Die Lektion sollte niemals vergessen werden. Darum: Wehren Sie den Anfängen. Sie sind es nicht nur uns, den wenigen Überlebenden, sie sind es sich selber und ihren Kindern und Kindeskindern schuldig. Wer ausländer-, wer fremden-, wer judenfeindlich ist, ist in Wahrheit auch deutschfeindlich, weil er menschen-, weil er lebensfeindlich ist. Die neuen Barbaren und ihre Einflüsterer sind die kleinen, hässlichen Gehilfen des Lebenshasses. Wir wissen: Uns rettet vor den Todesschwadronen des neuen Jahrhunderts und vor den schwelenden Konflikten, die sie schüren, zuletzt nur die Liebe zum Leben, die aus der Ehrfurcht vor dem Leben stammt. Die Lebensliebe, die sich in einer unbeirrbaren Vernunft und einem unbeirrbaren Anstand äußert. Ich danke Ihnen.Frankfurter Rundschau, 13.04.2002