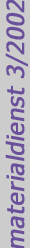"Wir wollten den Krieg und nu?"
Eine Bar Mitzwa-Feier in der Nachbarschaft
von Jörg Bremer
JERUSALEM, 15. April 2002. Frau Schapiro, die Dame mit den langen Krausehaaren und dem kniekurzen roten Rock, trägt ihre Baretta-Pistole im Täschchen über die Schulter. Sonst würde sie doch gar keine Tasche tragen, sagt sie: "Ich pudere doch nicht mein Näschen oder brauche Lippenstift". Die beiden Wachmänner mit ihren schwarzen Jacken lassen Frau Schapiro passieren. Der Nachbarjunge Boas feiert seine Bar Mitzwa. Das ist in etwa die Konformation bei Jungen jüdischen Glaubens und ein fröhliches Fest. Boas` Eltern haben dafür aus ihrem Haus eine Festung gemacht und aus ihrem Salon eine Synagoge. Links vom Thoraschrein zum Garten hin sitzen Frau Schapiro, die anderen Frauen und Mädchen. Ihnen gegenüber die Männer und Jungen. "Die Freunde und Verwandten würden doch in diesen Tagen kaum nach Jerusalem kommen, wenn wir nicht die Wachen vor der Tür hätten und hohe Mauern", sagt Boas` Vater. So ein Bar Mitzwa-Gottesdienst ist langwierig, zumal wenn gerade der Tag der längsten Losung ansteht, und ein neuer jüdischer Monat beginnt. Boas hat für Monate seinen Vortrag eingeübt, das melodische Singen und das richtige Betonen. Aber auffälliger sind doch die vielen Pistolen, die die Männer an ihren Gürteln tragen. Dabei ist Boas` Familie weder politisch "rechts"; noch sind viele Siedler unter den Gästen. Im Gegenteil: "Dies ist das linke Israel, das mit den Palästinensern und Arafat Frieden schließen wollte", sagt ein anderer Nachbar. Jerry Goodman verlor jüngst seinen jüngsten Sohn bei einem Unfall. "Eitan war kerngesund, einer der besten Sportler Israels; noch als er im Koma lag, boten wir seine Organe zum Spenden an. Neulich kam ein Araber, und der hatte durch Eitan sein Augenlicht wieder, und einer arabischen Frau schlägt wieder ein gesundes Herz." Das gebe es auch, sagt Jerry und weint ein bißchen. Jerry ist kein typischer Nachbar. Er heiratete einst eine katholische Frau, die dann konvertierte. Offenheit verbindet ihn auch mit den Arabern, die weiter bei ihm arbeiten. "Aber unserer Gespräche sind härter geworden. Mohammad wirft uns Israelis Massaker vor; ich geißle die Morde. Wir sind trotz unserer brüderlichen Bande nicht mehr frei von diesem Nationalitätenkampf. Ich hoffe, wir werden keine Feinde." Boas' Mutter kämpft seit Monaten gegen eine Depression. "Wie könnte das Leben schön sein? Wir haben eigentlich keine Sorgen; aber der Druck durch diese Selbstmordattentate, das Leid der anderen Seite - mich macht "dies alles" fast wie lebensmüde". Sie kann auch heute kaum lachen und geht später unschlüssig zwischen den dargebotenen Speisen, Suschi oder Pasta hin und her. Längst flogen die Bonbons auf Boas "für eine süße Zukunft in unserer jüdischen Gemeinde". Er, seine Geschwister und die Freunde spielen nun Fußball. Da kommt beim Kaffee unter Sonnenschirmen im Garten wieder das Gespräch auf das einzige Thema: "Wir Juden können doch machen, was wir wollen. Die Welt schneidet uns den Hals ab." Das sagt Schmuel Ben-Tovim, der reiche Bauunternehmer, der sich auch zu den "Linken" zählt. Die Welt müsse begreifen, daß sich dieser Selbstmordterror bald ausdehnen werde. "Wenn er bei uns Erfolg hat, dann wird er zur Sprache der Muslime gegen den Westen überall." Schmuel beklagt sich über die Europäer mit ihren blauäugigen Vorstellungen vom Islam, als sei Lawrence von Arabien noch lebendig. "Die Araber ticken anders, zählen anders, und sie haben eine andere Wahrheit. Das muß ja nicht schlecht sein, aber wenn man sich mit ihnen unterhält, muß man das wissen. Der Frieden kam doch hier bisher deswegen nicht, weil (Ministerpräsident) Barak diese "andere Sprache" nicht verstand." Als ob Scharon sie verstehe, fährt Jerry dazwischen, und Janet, die ihr Leben für "Frieden Jetzt" gibt, findet: "Weil wir Israelis ihre Sprache nicht verstehen wollen, greifen wir zu Gewalt, Entrechtung und Erniedrigung". Sie berichtet über das, was sie so gehört hat, aus dem zerstörten Flüchtlingslager von Dschenin, von den enteigneten Familien bei Har Hasina, von den Soldaten an Kontrollpunkten, die Araber dazu bringen, sich vor ihnen und ihren Kindern auszuziehen, bis sie vielleicht weiterdürfen. Die Gäste, die nicht schon längst aus Ablehnung oder Resignation zu anderen Gruppen im Garten stießen, so zum Clan um Frau Schapiro, die offenbar einen guten Frisör in Raanana bei Tel Aviv auftat, hören Janet geduldig zu. Schmuel ergänzt noch einiges und findet dann: "Vielleicht sind wir den Arabern ganz gleich; denn würden dasselbe nicht die Araber mit uns auch machen? Haben sie es nicht oft genug in den osmanischen Zeiten mit ihren Abhängigen, mit Juden und Christen so gemacht?" Aber der Gedanke wird nicht weiterverfolgt. Boas Vater bringt den Cognak, und Jerry weiß sich mit den meisten darin einig: "Wir wollten doch alle, daß nach dem letzten Selbstmordanschlag in Netanja etwas ganz Eindeutiges geschah. Der Anschlag mitten beim Pessach-Seder war ein Anschlag auf das gesamte Judentum; wie wenn einer zu Weihnachten in den Kölner Dom eine Bombe wirft", ergänzt Jerry in Richtung des Deutschen. "Darum sei seitdem die Solidarität aller Juden mit Israel noch stärker geworden." Selbst Janet findet: "Wir wollten den Krieg, und nun....?" Diese Frage bleibt offen, denn der Fußball unterbricht die Aufmerksamkeit. Er landet auf der Kaffee-Tafel. Der französisch sprechende Tisch um Frau Schapiro biegt sich vor Lachen. "Das habt ihr von eurer Ernsthaftigkeit, gerade an so einem Tag", ruft es herüber. Dieser deutsche Journalist sei daran schuld, lautet die Antwort. Nun muß der Deutsche von seinen Eindrücken berichten. Sein düsteres Bild schließt auch Gerüchte von stehlenden Soldaten ein. Da meldet sich Jerry`s Frau zu Wort, eine Sonderschulerzieherin, die bisher mit einer besorgten Mutter über den Streß der Kinder in der Krise geredet hatte. Jerry`s Frau sagt: "Ich konnte es erst nicht glauben. Aber dann hat unser Ältester über diesen Sport berichtet. Das sei ein Hobby in manchen Einheiten, schimpfte (der Sohn) Reuven." Es gehe darum, den Palästinensern möglichst besonders Wertvolles zu stehlen. Wer also eine kostbare Uhr eingesackt habe, stehe bei seinen Soldatenkollegen besser da als einer, der nur ein paar Schekel mitnahm. "Reuven war empört, als er das mitbekam und hat seinem Kommandeur alarmiert. Vor allem in Ramallah, aber auch anderswo kam es dazu." Das könne man doch gar nicht glauben, empören sich die meisten in der Runde. "Rueven hat es auch erst nicht geglaubt, bis der Spieß ihm die Beweise vorlegte. Seither wird die Sache verfolgt - aber unter der Hand," schließt Jerry`s Frau ihren Bericht. Dem Reporter hätten sie nicht geglaubt, aber nun gucken sie mit betroffenen Gesichtern in die Menge. "Unglaublich", findet der Bauunternehmer. "Ungeheuer", findet auch Frau Schapiro. Sie wolle noch vor der Abfahrt ihres Sohnes wieder in Tel Aviv sein. "Der hatte jetzt für ein paar Urlaub von der Truppe und geht wieder zurück in den Krieg". Über die Köpfe rast ein F-16 Jet. "Das ist kein gutes Zeichen", sagt Jerry. Janet will auch nachhaus. Sie hat Medikamente und Paprika eingekauft. "Die soll mein Sohn Familien in Bethlehem über den Zaun werfen, die wir kennen". Und was sei da in Dschenin wirklich passiert? Wirklich ein Massaker, will der Bauunternehmer noch wissen? "Immerhin kamen von dort die meisten Attentäter. Die konnten fliehen; und wenn sie es nicht taten, verdienten sie ihr Los." Der Reporter will noch wissen, ob Außenminister Powell jetzt in der Region eine Chance habe. Die erste Antwort geht fast im Krach eines weiteren Jet unter. "Solange Powell nicht von (US-Vizepräsident) Cheney oder (Verteidigungsminister) Rumsfeld unterstützt wird, solange also die zwei starken Männer in Washington schweigen, wird (Premier Scharon) nicht auf ihn hören und die Truppen nicht abziehen lassen." Was solle das auch mitten in der Kampagne, findet Frau Schapiro, die den Rock geglättet und ihre Baretta im Täschchen zum Abgang bereit wieder über die Schulter hängt: "Die Amerikaner konnten sieben Monate lange in Afghanistan den Terror bekämpfen, und wir sollen schon nach sieben Tagen aufhören?", zitiert sie eine Großanzeige der vergangenen Woche. Die Mehrheit der Israelis denkt wie sie, auch noch nach vierzehn Tagen Feldzug.