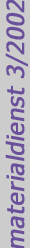Jerusalem, Jerusalem
Gedanken beim Anblick einer zerrissenen Stadt
von Imre Kertész
Im April 2002 Vorgestern Abend noch sah ich vom Balkon des Renaissance-Hotels den Sonnenuntergang in Jerusalem. Über den gegenüberliegenden weißen Hügeln verblasste der Himmel, von der Altstadt her kam ein leichter Wind auf, plötzlich brach das Licht, und die einfallende Dämmerung war wie ein melancholischer Waffenstillstand - Camus' Worte aus dem Fremden gingen mir durch den Sinn. Doch am Morgen flog der Bus von Haifa nach Jerusalem in die Luft, die Wucht der Detonation riss den Wagen empor, abgerissene menschliche Körperteile flogen durch die Luft. Ich versuche meine konfus umherschweifenden Gedanken beim Anblick der dämmernden Stadt nicht einmal zu ordnen. Ich bin mit meiner Frau zu einer Konferenz hergekommen, zu der ich nie gegangen wäre, wenn sie nicht gerade hier in Jerusalem stattfinden würde. Ich liebe fruchtlose Konferenzen nicht, insbesondere jene, die solche Titel tragen wie The Legacy of Holocaust Survivors - Moral and Ethical Implications for Humanity. Das Datum, 9. April, stand seit Monaten in meinem Notizbuch, und obwohl ich so tat, als würde ich den dringenden Rat meiner Berliner und Budapester Freunde ernsthaft in Erwägung ziehen - meist rieten sie von der Reise ab -, stand ich in Wahrheit bis zuletzt ganz im Bann meines ursprünglichen Plans: Wir fahren von Berlin nach Budapest zurück, ich gebe bei den dortigen Wahlen meine wahrscheinlich völlig überflüssige Stimme ab, und zwei Tage später brechen wir nach Jerusalem auf. Die einzige Frage, die sich wirklich stellt, ist, ob ich nicht besser allein fahren soll. Doch davon will meine Frau nichts wissen. Zusammen oder gar nicht. Nach einigem Überlegen wird uns klar, dass wir fahren müssen, einfach, weil wir danach immer mit dem Gedanken leben müssten, dass wir gerufen worden, aber nicht gegangen sind. Ich habe begriffen, warum die Götter hier geboren wurden Nun also stehe ich hier auf dem Balkon im siebten Stock und kann das, was wirklich vor sich geht, genauso schwer beurteilen wie in Berlin oder Budapest. Ich denke in diesem Augenblick nicht einmal über die hiesige Situation nach, eher über die europäische Reaktion. Es scheint, als würde aus dem Bodensatz des Unterbewussten, einem schwefeligen Lavaausbruch gleich, der viele Jahre in Zaum gehaltene Antisemitismus wieder aufblubbern. Auf dem Bildschirm sehe ich, in Jerusalem ebenso wie anderswo, gegen Israel gerichtete Demonstrationen. Ich sehe die in Frankreich in Brand gesetzten Synagogen und geschändeten Friedhöfe. Nur einige hundert Meter von meinem Berliner Domizil entfernt, am Tiergarten, sind zwei junge amerikanische Juden auf der Straße angegriffen und zusammengeschlagen worden. Ich sah den portugiesischen Schriftsteller Saramago im Fernsehen, wie er, über ein Blatt Papier gebeugt, Israels Vorgehen gegen die Palästinenser mit Auschwitz verglich - ein Zeugnis dafür, dass der Autor nicht die geringste Ahnung von der skandalösen Irrelevanz des von ihm angestellten Vergleichs besaß, ja, mehr noch, dass der unter dem Namen Auschwitz bekannte Begriff, der bislang im kulturellen Konsens Europas eine feste Bedeutung hatte, heute bereits ohne weiteres in populistischer Art, zu populistischen Zwecken benutzt werden kann. Ich frage mich, ob man die Israel-feindliche Gesinnung nicht trennen muss vom Antisemitismus. Aber ist das möglich? Wie ist es zu verstehen, dass es zwei Kontinente weiter weg, in Argentinien - wo doch die Menschen im Übrigen gerade genug eigene Sorgen haben -, zu Anti-Israel-Kundgebungen kommen kann? Wahrscheinlich so, überlege ich, dass die seit etwa 2000 Jahren währende Judenfeindseligkeit sich zum Weltbild verfestigt hat. Der Hass hat sich zum Weltbild verfestigt, und Gegenstand des Hasses ist ein Volk geworden, das in keiner Weise bereit ist, von der Erdoberfläche zu verschwinden. Ich versuche, klar und vollkommen aufrichtig zu denken, und was ich denke, klar und aufrichtig, jedes Tabu beiseite schiebend, vor mir selbst auszusprechen. Dass sich junge Menschen mit heller Lust selbst in die Luft sprengen (im Übrigen lese ich in der Zeitung, dass der irakische Diktator Saddam Hussein ihren Familien 25 000 Dollar zahlt), deutet darauf hin, dass es nicht nur darum gehen kann, ob sich ein palästinensischer Staat konstituiert oder nicht. Diese Selbstmörder weisen sich als Verlierer des Daseins aus. In ihrer Tat kommt eine Verbitterung zum Ausdruck, die sich mit nationalistischen Affekten allein nicht erklären lässt. Im sanften Licht Jerusalems, an goldenen Abenden, inmitten dieser malerischen, mit Olivenbäumen bewachsenen Hügel habe ich einmal auf einer früheren Jerusalemreise, mehr mit den Sinnen als mit dem Verstand, begriffen, warum die Götter gerade hier geboren wurden. Jetzt müsste ich begreifen, warum sie hier, mit einer sich selbst zur Schau stellenden Bereitschaft zum blutigen Menschenopfer, abgeschlachtet werden. Ich gestehe, ich begreife nichts, und ich vermag nicht zu glauben, dass wir lediglich einer politischen Frage gegenüberstehen. Es kann aber auch sein, dass die Politik darauf abzielt, dass ich das alles nicht nur als politische Frage ansehe, und ich bin lediglich Opfer einer Manipulation; doch während Millionen auf die Manipulation hereinfallen, verwandelt sich der Charakter dieser Manipulation, wird sie verinnerlicht - einige Leute denken plötzlich allen Ernstes, ihr Wahnsinn sei nicht von äußeren Mächten eingegeben, sondern bräche aus ihrer eigenen Seele, ihrer eigenen Seelenpein hervor: Und da beginnt das irreparable Übel. Ich gestehe ehrlich: Als ich im Fernsehen zum ersten Mal die auf Ramallah zurollenden israelischen Panzer erblickte, durchfuhr mich unwillkürlich und unabweisbar der Gedanke: Mein Gott, wie gut, dass ich den Judenstern auf israelischen Panzern sehe und nicht, wie 1944, auf meiner Brust. Ich bin also nicht unbefangen und kann es auch nicht sein. Nie habe ich die Rolle des unparteiischen Scharfrichters gespielt . Das überlasse ich jenen europäischen - und nichteuropäischen - Intellektuellen, die dieses Spiel so glänzend und oft zum Schaden spielen. Nach so viel wahrer und falscher Solidarität hat sich das Blatt diesmal gewendet: Die Mandarine haben sich mit strengem Gesicht gegen Israel gewandt. In gewissen Fragen mögen sie offensichtlich auch Recht haben, nur dass sie noch nie ein Ticket für den Bus von Haifa nach Jerusalem gelöst haben. Das kühle Urteilen der europäischen Mandarine Hier in Israel trägt, bildlich gesprochen, jeder dieses Ticket in der Tasche. Und diese Tatsache bringt die Menschen langsam um den nüchternen Verstand. Das kühle Urteilen der europäischen Mandarine lebt man hier in Form brennender existenzieller Fragen aus. Am prägnantesten hat diese Zerrissenheit wohl eine Freundin ausgedrückt, als sie in Jad Vaschem, diesem furchtbaren Friedhof der im Holocaust Ermordeten, zu uns sagte: »Erst gehen wir mit der Familie auf eine Demonstration gegen den Krieg, dann rücken wir bei der Armee ein.« Ich habe - zumindest hier, bei dieser Konferenz - keinen israelischen Intellektuellen getroffen, der die Notwendigkeit eines palästinensischen Staates bezweifelt hätte. »Die israelischen Ansiedlungen dort müssen beendet werden«, sagt einer der leitenden Historiker von Jad Vaschem, »das zieht dann so etwas wie einen Minibürgerkrieg nach sich, aber den müssen wir ausfechten.« Die Isolierung, der Mangel an Solidarität, bereiten geradezu physischen Schmerz. Unmöglich, den Terror tatenlos zu erdulden, und unmöglich, dem Terror ohne Terror entgegenzutreten. Eine peinigende Zwangssituation, quälende Fragen, mit denen man allein fertig werden muss. »Man sperrt uns in ein moralisches Ghetto«, sagt mein Freund Aharon Appelfeld, der Schriftsteller. In den Blicken um mich her sehe ich Angst, Ratlosigkeit und Entschlossenheit. Genau so, wie David Grossmann es in seinem dramatischen Beitrag in der FAZ beschreibt: »Das Israel von heute gleicht einer geballten Faust, aber auch einer Hand, die vor Verzweiflung erschlafft hinabsinkt.« Die Stadt ist ausgestorben, die Taxifahrer kreisen wie gierige Habichte um die Hotels, sobald jemand aus der Tür tritt, fallen sie über ihn her - meist umsonst, denn es sind ja kaum andere hier als diejenigen, die irgendwelche offiziellen Aufgaben hergeführt haben und die warten, dass sie offiziell abgeholt zu werden. In unserem Hotel frühstücken wir in einem halb leeren Raum, die Touristen bleiben aus, auch die krawattengeschmückten Herren, die bei ihrem Kaffee Zeitung lesen, die üblichen Geschäftsleute. Fast habe ich darüber vergessen, dass auch ich zu einer Konferenz hierher gekommen bin und meinen vorbereiteten Text vortragen muss. »Wenn ich sage, ich bin ein jüdischer Schriftsteller, sage ich damit noch nicht, dass ich auch selbst Jude bin«, lese ich. »Denn was für ein Jude ist jemand, der keine religiöse Erziehung erhalten hat, nicht Hebräisch spricht, die Quellenwerke der jüdischen Kultur im Grunde kaum kennt und nicht in Israel, sondern in Europa lebt? Jemand, für den die primäre, ja vielleicht die ausschließliche jüdische Identität Auschwitz ist, ist in gewisser Weise doch nicht Jude zu nennen. Er ist der 'nichtjüdische Jude', von dem Isaac Deutscher spricht, die entwurzelte europäische Abart, die zu dem ihr aufoktroyierten Judentum kaum noch eine innere Beziehung findet.« Fast schäme ich mich, diese Zeilen vorzulesen. Fast schäme ich mich, meine Existenzform offen zu legen, die subtilen Probleme des entwurzelten jüdischen Intellektuellen, Identitätskrise, Heimatlosigkeit. Auf einmal durchschaue ich die unerträgliche Ironie meiner Rolle: Als Überlebender der Shoah halte ich einen Vortrag auf dem Boden Israels, das im Krieg steht, und erkläre - im Grunde genommen -, warum ich nicht solidarisch sein kann mit dem Volk, zu dem auch ich gehöre. Meine Solidarität besteht allenfalls darin, dass ich wagte, ein Flugzeug nach Tel Aviv zu besteigen. Ich bin ein Besucher, der unnütz Eindrücke sammelt, umsonst Menschen befragt; verstehen wird er sie nicht, denn er teilt das Los derer nicht, zu denen er eigentlich gehört. So entschieden habe ich das noch nie empfunden. Als sei ich nun, da mich Mitgefühl und Anteilnahme geradezu mit Qual erfüllen, noch fremder hier. Kein einziger Israeli versäumt es, uns zu danken, dass wir zu ihnen gekommen sind. So endet fast jedes Gespräch, und meine Fremdheit hebt sich dadurch nur noch stärker heraus. Ich überlege, warum das so ist, und als ich die Gesichter, die beflaggten Autos, diese schwer zu definierende, erregte und geschlossene Stimmung der Stadt noch genauer betrachte, wird mir plötzlich die Veränderung bewusst, die dieses Land gerade jetzt durchmacht. Der französische Historiker Ernest Renan behauptet, dass nicht die Rasse und auch nicht die Sprache die Nation definieren: Die Menschen spürten im Herzen, dass ihr Denken und Fühlen, ihre Erinnerungen und Hoffnungen sie miteinander verbinden. Nun, dieses Land, das bislang teils für die Gründerväter, hauptsächlich jedoch für die europäischen Überlebenden, für die Schutzsuchenden, für militante Zionisten, rigorose Soldaten, sanfte Musiker, für nördlich weiße und afrikanische, arabische und levantinische Juden vielerlei Couleur, die verschiedenartigsten Kulturen und die verschiedenartigsten Menschen ein inkohärentes Land war, hat sich nun, im Laufe dieses verzweifelten und ausweglosen Krieges, mit einem Mal zur Nation geformt. Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen oder ob man es eher verfluchen soll, denn die Zeit der Nationen neigt sich eben jetzt dem Ende zu, doch es ist eine Tatsache, und sie lässt das mit gewissen Vorbehalten, zugleich mit lächelnder Sympathie, manchmal mit überlegener Ironie einhergehende Verhalten, mit dem europäische und amerikanische Juden sich bisher Israel näherten, nicht länger zu. Es ist eine seltsame Wende, und diese Wende wird - zumindest im jüdisch-jüdischen Verhältnis - ohne Zweifel ihre Auswirkungen haben. So tue ich also gut daran, wenn ich hier nicht nach der Wahrheit, der so genannten objektiven Wahrheit suche. Und »ist die 'Wahrheit' nicht ein für allemal gegeben, sondern ist sie wandelbar, so muss desto tiefer, gewissenhafter und empfindlicher die Sorge sein des geistigen Menschen um sie, seine Achtsamkeit auf die Regungen des Weltgeistes, auf Veränderungen im Bilde der Wahrheit«, wie es Thomas Mann in einem der kritischsten Jahre Europas formuliert hat. Vielleicht gerade, weil sie so wandelbar ist, spielt sich die »Wahrheit« zurzeit derartig in den Vordergrund, fordert unablässig nach ihrer aktuellen Definition. Die Kriege unserer Epoche sind, in einem vielleicht noch nie erreichten Ausmaß, immer moralisch gefärbte Kriege. In unserer modernen - oder postmodernen - Welt verlaufen die Grenzen nicht so sehr zwischen Nationen, Ethnien und Konfessionen als vielmehr zwischen Weltanschauungen und Welthaltungen, zwischen Vernunft und Fanatismus, Toleranz und Hysterie, Kreativität und zerstörerischer Herrschsucht. In unserer ungläubigen Epoche finden biblische Kriege statt, Kriege zwischen dem »Guten« und dem »Bösen«. Auch diese Begriffe müssen wir mit Anführungszeichen versehen, weil wir einfach nicht wissen, was das »Gute« und was das »Böse« ist. Unsere Begriffe davon sind zu verschiedenartig, zu divergent, und sie werden umstritten bleiben, solange nicht wieder ein festes Wertesystem einer gemeinsam gestalteten und gemeinsam getragenen Kultur entsteht. Das ist, besonders hier im Nahen Osten, natürlich nur Utopie. Womit lässt sich erklären, grübele ich, dass sich tatkräftige junge Menschen zu selbstmörderischen Terrorakten entschließen? Was für einen Wert sie dem Leben anderer beimessen, machen ihre Taten klar; doch wie bemessen sie den Wert ihres eigenen Lebens? Ein Freund erklärt uns, dass ihnen erzählt wird, »drüben«, im jenseitigen Harem, warteten 72 Jungfrauen auf sie und verwöhnten sie dann. Und was erzählt man den Frauen?, frage ich. Unser Freund zuckt lachend mit den Schultern. Ich habe den Hass immer als Energie wahrgenommen. Energie ist blind, doch ihre Quelle ist paradoxerweise dieselbe Vitalität, aus der sich auch die kreativen Kräfte nähren. Die europäische Zivilisation, zu der die Menschen sich hier immer noch und trotz allem als der ihren bekennen, erachtet die Vervollkommnung des menschlichen Lebens als edelsten Wert. Der Fanatismus ist genau das Gegenteil dessen; auf welcher Basis können hier je Menschlichkeit und Vertrauen entstehen? Einstweilen herrschen Angst und Hass. »Worte über Frieden, Versöhnung, Koexistenz klingen heute wie die letzten Lebenszeichen aus einem Schiff, das schon gesunken ist«, schreibt David Grossmann. In dieser Gegend fällt die Dunkelheit plötzlich herab; unten auf der Straße, unter meinem Balkon, flammen die Lampen auf. Autos rasen über die sich in der Ferne verlierenden Straßen, die zu Orangenhainen und zu den Universitäten führen, zu wohl gebauten Städten und wohl bestellten Feldern. Viele haben uns erzählt, dass sie nach der Shoah hierher gekommen sind, weil sie sich Ruhe und Sicherheit erhofften. Dieses Land ist mit harter Arbeit aufgebaut worden, seine Einwohner mussten es in harten Kämpfen verteidigen, während von der näheren und weiteren Umgebung seine Existenzberechtigung in Zweifel gezogen wird. Wenn dieser Zweifel - gepaart mit dem Gefühl des Alleingelassenseins - auch in ihnen Wurzeln schlägt, könnte sie das in tiefste Verzweiflung stürzen. Zurzeit macht, zumindest nach meinen Erfahrungen, die Vitalität des Landes noch Selbstreflexion möglich: Wenn natürlich auch nicht der Widerstand gegen den Terror, so wird doch die Art der Verteidigung, der letzten Endes ergebnislose Rachefeldzug, von der Mehrheit der Intellektuellen im Land leidenschaftlich kritisiert. Doch wenn die feindselige Gleichgültigkeit der Welt sie wirklich der Verzweiflung überlässt, ist alles für die Katastrophe offen; und in dieser mit Hass, fanatischen Wahnvorstellungen und Ohnmacht erfüllten Welt wird die Katastrophe keineswegs nur den Nahen Osten betreffen. Ich bin nicht verstanden worden, vielleicht ist es richtig so Mit schwerem Herzen verlasse ich den Balkon, den Anblick des nächtlichen Jerusalem. Morgen Abend reisen wir ab, und ich nehme ein besonderes Geschenk von hier mit. Nation, Heimat, Zuhause - das waren für mich bisher unzugängliche Begriffe. Die Harmonie des Citoyen, der sich bedingungslos mit seiner Heimat, seiner Nation identifiziert, ist für mich unvorstellbar. Mein Schicksal hat es mit sich gebracht, dass ich in einer selbst gewählten und akzeptierten - man könnte sagen: weltweiten - Minoritätssituation lebe, und wenn ich diese Minoritätssituation genauer definieren wollte, würde ich dazu keine rassischen und ethnischen und auch keine konfessionellen oder philologischen Begriffe benutzen. Ich würde die akzeptierte Minoritätssituation als eine geistige Lebensform definieren, die auf der Erfahrung des Negativen basiert. Es ist wahr, die negative Erfahrung ist mir durch mein Judentum zuteil geworden. Ich könnte auch sagen, durch mein Judentum wurde ich in die universelle Welt der negativen Erfahrung eingeweiht; denn alles, was ich wegen meiner jüdischen Abstammung durchleben musste, sehe ich als Initiation, als Einweihung in das tiefste Wissen vom Menschen und seiner heutigen Situation. Und dadurch, dass ich mein Judentum als negative Erfahrung, das heißt radikal, durchlebt habe, hat es schließlich zu meiner Befreiung geführt. Es ist die einzige Freiheit, die ich mir während meines unter verschiedenen Diktaturen verbrachten Lebens erworben und gerade deshalb sorgsam bewacht habe - bis zum heutigen Tag. Jetzt, während meines Jerusalemer Aufenthalts, hat mich zum ersten Mal das ernste und erhebende Gefühl nationaler Verantwortung berührt; und wenn ich mir auch bewusst bin, dass ich damit nichts anfangen kann, weil mein Leben längst entschieden ist, hat es mich doch tief erschüttert. Mit dieser Erschütterung besteige ich das Flugzeug nach Budapest. Der Sicherheitsoffizier, ein junges Mädchen, dankt uns, nachdem es die obligaten Fragen gestellt und unser Gepäck in Ordnung gefunden hat, dafür, dass wir hierher gekommen sind, »zu uns, nach Israel«. Dieser Dank ist wie eine knappe Entbindung von allen weiteren Pflichten, und ich sehe, dass es meine Frau, die weder durch Blutsbande noch durch Religion, allein durch die Liebe mit diesem Land verbunden ist, genauso schmerzt wie mich. Unsere Maschine landet glücklich in Budapest. Beim Hinausgehen kann ich es nicht unterlassen, dem diensttuenden Personal an der Tür ein »God save Israel!« zuzurufen. Doch ich mag die Worte schlecht ausgesprochen oder eines verfehlt haben, jedenfalls vernahm ich hinter mir befremdete Fragen: »What did he say?« Bevor ich mich umdrehen kann, bin ich schon weiter hinausgedrängt, nach draußen. Ich bin nicht verstanden worden. Vielleicht ist es richtig so. Ich verlasse das Flugzeug, betrete ungarischen Boden. Imre Kertész, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 nach Auschwitz deportiert und 1945 in Buchenwald befreit. Sein »Roman eines Schicksalslosen« machte den Schriftsteller weltberühmt. Aus dem Ungarischen Laszlo Kornitzer,DIE ZEIT, 25.4.2002