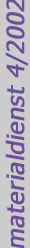Die israelische Mauer
Am Rand des Westjordanlandes entsteht ein Schutzwall - eine provisorische, keine endgültige Grenze
von Gisela Dachs
GilboaDaniel Atar weiß, dass das Wort Mauer gerade für deutsche Ohren keinen guten Klang hat. "Ich war selber nie in Berlin, aber mir ist natürlich klar, was die Teilung für die Menschen dort bedeutet hat." Doch angesichts der unerträglichen Sicherheitslage hält der Bürgermeister von Gilboa einen Trennungszaun erst einmal für unerlässlich. Für den 44-jährigen Israeli, seit acht Jahren im Amt, beginnen die Probleme buchstäblich vor der Haustür. Sein Verwaltungsbezirk mit 22 500 Einwohnern befindet sich direkt an der Grünen Linie, die Israel vom Westjordanland trennt. Vom Rathaus in Gilboa bis nach Dschenin, eine Hochburg der Hamas-Bewegung und des Islamischen Dschihad, sind es nur zwei Kilometer. Zwar wird die Verbindungsstraße von der Armee streng kontrolliert, doch zu Fuß kommt jeder leicht über die blühenden Felder und steinigen Hügel auf die andere Seite. Nach dem Beginn der bewaffneten Intifada im September 2000 wurde Gilboa quasi zu einer Kriegszone. Militante Palästinenser stapften durch die Gärten, griffen Bürger an, legten Waldbrände, stahlen landwirtschaftliches Gerät. Seither warb Atar für den Bau eines Sicherheitszauns, der zum einen die Zahl der Selbstmordanschläge in Israel verringern und zum anderen den Soldaten den Rückzug aus dem Westjordanland erlauben würde. Vor einem Jahr überzeugte Atar die Armee, direkt an der Grünen Linie wenigstens eine meterhohe grün-orange gestrichene Barriere zu errichten, um Autos aufzuhalten - das war der Anfang einer mittlerweile breiten Volksbewegung für einen Zaun, für die Trennung von den Palästinensern. Löchrig wie ein Schweizer Käse Am vergangenen Sonntag hat das Kabinett nun offiziell den Bau eines Schutzwalls zwischen Israel und den Palästinensern beschlossen. In den nächsten Monaten wird ein mit Sensoren, Wachtürmen und Gräben gesicherter Gitterzaun errichtet. Atar begrüßt die Entscheidung, hält sie aber für unzulänglich. Denn die Regierungspläne von einer bisher nur 115 Kilometer langen Trennlinie seien "so löchrig wie ein Schweizer Käse". Um wirklich effektiv zu sein, sagt er, müsse der Zaun entlang der gesamten Grünen Linie verlaufen, "von Beit Shean an der jordanischen Grenze bis zum Toten Meer, insgesamt 364 Kilometer". Weil ein solches Vorhaben nicht nur politisch schwer durchzusetzen ist, sondern auch viel Geld kostet - eine Million Dollar pro Kilometer Zaun -, ruft Atar nun zu Spenden auf. Seine Initiative heißt Fence for Defense now (http://fencefordefensenow.org) und soll nicht nur seine Landsleute, sondern am besten auch den amerikanischen Präsidenten George Bush von der Notwendigkeit der Trennung überzeugen. Damit hat der Bürgermeister von Gilboa eine 180-Grad-Wende vollzogen. Noch vor zwei Jahren plante er mit dem palästinensischen Gouverneur von Dschenin, Suhair Manasre, eine gemeinsame Industriezone im Grenzgebiet. Im Einzugsbereich von Dschenin leben 70 000 Menschen; für Atar - als engagiertes Mitglied der Arbeitspartei - lag eine Zusammenarbeit nahe. Man vereinbarte wirtschaftliche, aber auch soziale Kooperation. Der deutsche Bundespräsident Johannes Rau legte den Grundstein für das international geförderte Projekt Kooperation Nord. Schulkinder aus Gilboa und Dschenin trafen sich, um zusammen ein Computerprogramm zum Thema Wassernot zu entwickeln. Mit seinem palästinensischen Partner aus Dschenin hatte Atar sich mit der Zeit angefreundet. Einmal waren die beiden sogar zusammen eine Woche lang als Gäste der EU in Deutschland unterwegs. Sie hatten sich dabei auch das Länderdreieck am Oberrhein als Kooperationsmodell angeschaut. Träume und Realitäten von gestern, die nur dann wieder aufleben werden, glaubt Atar, wenn Ruhe eingekehrt sei. So populär die "Mauer" inzwischen bei den Israelis ist, so skeptisch zeigen sich die Politiker. Ministerpräsident Scharon hat sich lange gegen das Konzept gewehrt, sich aber schließlich seinem Verteidigungsminister Ben-Eliezer gefügt. Der ist Mitglied der Arbeitspartei und Architekt des Zauns. Benjamin Fuad Ben-Eliezer sprach von einem "neuen Abschnitt in der Verteidigung der Bürger Israels", betonte aber bei der Entscheidung im Kabinett, dass damit keinesfalls einer Grenzziehung Vorschub geleistet werde. "Dies ist kein Trennungszaun für politische und diplomatische Zwecke, und ich schlage vor, dass wir ihn alle nur durch Sicherheitsbrillen betrachten. Ansonsten würden wir ihn nie bauen." Die Armee ist der Ansicht, ein solcher Schutzwall werde 80 bis 90 Prozent der Anschläge im Kernland Israel verhindern. Die nach Ben-Eliezer benannte Fuad-Linie soll von Kfar Salem neben Megiddo bis Kfar Kassem entlang der Grünen Linie verlaufen - allerdings mit kleinen "Korrekturen". Denn man wolle keinesfalls den alten Grenzen von 1967 neuen Atem einhauchen, heißt es in der Regierung. Faktisch aber ist der Zaun eine Grenze, die zwei miteinander im Krieg stehende Bevölkerungen separiert. Mit diesem Argument hatte auch der ehemalige Ministerpräsident Ehud Barak vor einem Jahr seinen Plan B der einseitigen Trennung vorgestellt. "Wenn wir uns nicht von den Palästinensern trennen, können wir kein jüdischer, zionistischer und demokratischer Staat bleiben. Wir werden entweder wie Bosnien und Belfast oder wie Südafrika während der Apartheid enden." Ein Schutzwall, argumentiert auch der Council of Peace and Security, ein hochrangiges Forum ehemaliger Generäle und Sicherheitsexperten, garantiere nicht nur eine bessere Terrorbekämpfung, sondern schaffe auch "demografische Sicherheit". Daniel Atar, auch Vorsitzender des Forums der Städte und Gemeinden an der Grünen Linie, zerbricht sich nicht den Kopf über mögliche politische Interpretationen des künftigen Zauns. Er grenze einfach das Gebiet ab, in dem israelisches Recht gilt - was, bitte schön, lasse sich dagegen einwenden? Es gibt aber auch Gegner des Trennungskonzepts - eine bunte Koalition, in der sich ganz verschiedene Gruppen zusammengefunden haben. Allen voran die Siedler, die östlich des Zauns zurückbleiben werden und um ihre Sicherheit und um den religiös motivierten Anspruch auf das Westjordanland als Siedlungsgebiet der Juden bangen. Gegen den Schutzwall sind auch die Palästinenser. Sie kritisieren die Landenteignungen, die für den Bau notwendig sind. Aufgeschreckt durch die Tatsache, dass der Zaun nicht exakt entlang der Grünen Linie, sondern stellenweise einige Kilometer weiter auf palästinensischem Gebiet verlaufen soll, befürchten sie, damit werde der Ausgang von Friedensverhandlungen und eine endgültige Grenze vorweggenommen. Andere Palästinenser haben Angst um ihre Existenz, wenn sie nicht mehr über die Grüne Linie zur Arbeit gehen können. Mauern lassen sich wieder stürzen Bürgermeister Daniel Atar hingegen sieht in dem Zaun nicht das Ende, sondern den Anfang eines Prozesses. Mauern, sagt er, lassen sich wieder einreißen: "Ich werde zu den Ersten gehören, die den Abriss fordern, wenn die Zeit dafür reif sein wird." Früher habe er geglaubt, dass ein Schritt nur dann Sinn mache, wenn beide Seiten davon profitierten. So denkt er heute nicht mehr. "Es geht mir in diesem Moment allein um die Bedürfnisse der israelischen Bevölkerung. Und die braucht dringend Sicherheit. Sonst schaffen wir es nie, zu den Denkkategorien des Friedens zurückzukehren." Für einen Zaun seien im Übrigen auch die 40 Prozent palästinensischen Bürger in seinem Bezirk. Sie, allen voran sein Stellvertreter im Rathaus, Eid Salim, dächten so wie er. Tatsächlich pflichtet Salim dem Bürgermeister bei. "Ich sehe aus meinem Schlafzimmerfenster (in dem Dorf Muqueible), wie leicht heute die Menschen von einer Seite der Grünen Linie auf die andere wechseln können. Wer gegen den Terror ist, muss für einen Zaun sein. Das heißt ja nicht, dass dieser keine Pforten haben darf." Wie die meisten palästinensischen Israelis in Gilboa hat auch Salim Verwandte in Dschenin. Er will aber, dass die Armee kontrolliert, wer von dort herüberkommt. "Denn ohne die Anschläge würden wir hier doch längst im Frieden leben." Atar sitzt neben ihm und blickt sorgenvoll auf den Bildschirm seines Laptops, der ihm gerade die jüngsten Daten der Wirtschaftskrise liefert. Sie hat Israel schwer getroffen, das Vertrauen in die Regierung schwindet. Atar verweist auf die jüngsten Umfragen, nach denen 52 Prozent der Bevölkerung nicht glauben, dass Scharon eine Lösung für die Terroranschläge hat. 69 Prozent der Israelis sind für einen Zaun, 52 Prozent für eine Trennung und die Evakuierung aller jüdischen Siedlungen im Gaza-Streifen und vieler im Westjordanland - sofort und ohne Verhandlungen. "Das ist die Meinung in dieser schwierigen Zeit", sagt Atar. "Jetzt können Sie sich vorstellen, wie viele Israelis für Kompromisse wären, wenn es wieder zu Verhandlungen kommt." DIE ZEIT, 27.6.2002