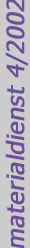Eifrige Suche nach Massengräbern
Die Israelis verstehen nicht, warum viele Europäer einseitig für die Palästinenser Partei ergreifen
von Gisela Dachs
Schwedens Botschafter in Tel Aviv hat sich bei Sarit Hadad entschuldigt. Er wurde bei der Sängerin vorstellig, weil der Moderator des Grand Prix Eurovision in seinem Land die Zuschauer vor laufenden Kameras dazu aufgerufen hatte, gerade der israelischen Teilnehmerin "in diesen Zeiten" keine Stimme zu geben. Die Schweden gaben ihr beim Wettsingen keinen einzigen Punkt. Für die Israelis war klar: Hadad bezahlte den Preis für die Wahrnehmung der Politik ihres Landes. Die Konsequenzen von Israels schlechtem Image in Europa gehen jedoch weit über populäre Gesangswettbewerbe hinaus: Hochtechnologiefirmen klagen über die Annullierung von Bestellungen in Dänemark, in einer norwegischen Supermarktkette werden Produkte aus Israel neuerdings mit Sonderaufklebern versehen, 120 europäische Professoren rufen zum akademischen Boykott israelischer Wissenschaftler auf. Ein Besuch im Europarat oder bei der Sozialistischen Internationale gerät für Israelis zum Spießrutenlauf. "Niemals seit der Gründung des Staates war die Kluft zwischen dem, was die Israelis über sich denken, und dem, was die Welt über sie sagt, größer", schrieb vor kurzem der Doyen der Kommentatoren, Nachum Barnea, in dem Massenblatt Yedioth Aharonot. Mittlerweile gibt es jede Woche irgendwo eine Veranstaltung zum Thema: Was läuft schief mit unserer Informationspolitik? Warum ist unsere Sichtweise gerade in Europa so schwer nachzuvollziehen? Kritik an der Regierung und am fortgesetzten Siedlungsbau gibt es auch in Israel zur Genüge. Was irritiert, ist der negative Tonfall in den Medien und aus dem Munde von Politikern, die die Bewohner des Nahen Ostens in Gute und Böse, in Besetzte und Besatzer aufteilen - als hätte es nie einen Versuch der Aussöhnung mit den Palästinensern gegeben. "Man tut so, als sei der Amtsantritt von Scharon die Stunde null des Konflikts", sagt Dany Schek im Jerusalemer Außenministerum. "Wer in Belgien Zeitungen liest, der glaubt, der Libanonkrieg (den Scharon 1982 als Verteidigungsminister geführt hat) war vor einer Woche. Belgische Kinder rufen uns aus der Schule an und bitten um Hilfe bei Arbeiten über das Massaker von Sabra und Schatilla (das christliche Milizen in dem palästinensischen Flüchtlingslager in Beirut unter den Augen der israelischen Armee begangen hatten)." Was Schek besonders ärgert, ist, dass Scharon in Europa geradezu dämonisiert werde, während Arafat unangetastet bleibe. "Solange Arafat nicht direkt beim Bombenlegen ertappt wird, bleibt er in Europa ein Symbol. Obwohl er so vieles verkörpert, was gegen demokratische Werte geht, gehört er zur Familie und nicht wir." Schek sieht Israel als Verlierer im Medienkrieg, weil "unsere Botschaft zu kompliziert und deshalb nicht telegen ist. Während die Palästinenser ein Ende der Besatzung fordern, reden wir von der Notwendigkeit eines Friedensprozesses mit glaubwürdigen Partnern, das hört sich nicht gut und griffig an. Unsere Botschaft ist geopolitisch, religiös und ethnisch. Sie ist verbal und nicht visuell." Es fällt auch leichter, israelische Panzer in palästinensischen Städten zu filmen als jenen Moment, in dem sich ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. Tatsächlich haben gerade die Fernsehbilder die Intifada geprägt: Zu den Meilensteinen gehörten die Unruhen auf dem Tempelberg Ende September 2000, die den Ausbruch der Intifada markierten, der Tod des 12-jährigen palästinensischen Jungen Mohammed Dura im Gaza-Streifen wenig später und die Invasion des Flüchtlingslagers von Dschenin im April 2002. Nicht immer aber entsprach die Darstellung der Wirklichkeit. So erregte gleich zu Beginn des Aufstands das Bild eines israelischen Polizisten, der über einem blutenden Palästinenser einen Prügel schwingt, die Gemüter. Am 30. September 2000 hatte die französische Libération das Foto mit der Schlagzeile Jerusalem - die Provokation zu ihrer Titelseite gemacht. In Wirklichkeit aber handelte es sich um einen jüdisch-amerikanischen Studenten, den der Polizist vor den Angriffen eines palästinensischen Mobs schützte. Die sichtbare Tankstelle im Hintergrund hielt andere Zeitungen nicht davon ab, den Schauplatz auf den Tempelberg zu verlegen. War es Unwissen? Arbeitsdruck? Oder politische Korrektheit, die automatisch für die vermeintlich Schwachen Partei ergreift? Auf die Richtigstellung anderer Falschmeldungen wartet Elli Pollak immer noch. Der Physiker ist der Vorsitzende von Israels Media Watch und klagt darüber, dass die Journalisten zu viel Macht hätten und viel zu wenig zur Rechenschaft gezogen würden. Im Fall von Dschenin hätten zu viele Reporter die palästinensischen Behauptungen, es habe ein Massaker gegeben, einfach übernommen. "Niemand hat sich nach der Liste der fehlenden Leichen erkundigt. Man war vielmehr ausgezogen, um nach Massengräbern zu suchen. Dass es am Ende der Schlacht nicht mehr als 56 palästinensische und 23 israelische Tote gab, darüber ist dann nicht mehr groß berichtet worden." Aber was soll ein Leser denken, wenn eine Reportage der französischen Nachrichtenagentur AFP in deutschen Tageszeitungen mit der folgenden Aussage eines palästinensischen Zeugen endet: "Nicht einmal Hitler hätte so etwas fertig gebracht"? Als ein weiteres Beispiel für einseitige Berichterstattung gilt den Israelis das Intifada-Symbol Mohammed Dura, der hinter dem Rücken seines Vaters kauernd vor laufender Kamera erschossen wurde. Sein dramatischer Tod ist auf Postern und Videoclips verewigt. In der ARD-Dokumentation Das Rote Quadrat stellte die Journalistin Esther Shapira, die bis dahin allgemein akzeptierte Version infrage, dass der Junge von israelischen Armeekugeln getroffen worden war. Für ihre Recherche wurde sie von propalästinensischen Kreisen in Deutschland beschimpft, als hätte sie damit ein schweres Tabu gebrochen. Die Reportage missfiel, weil sie nicht dem gewünschten Bild entsprach. Amnon Rubinstein, ehemaliger Erziehungsminister und Abgeordneter der linkssäkularen Meretz-Partei, spricht von einem "tiefen allgemeinen Missverständnis" der Verhältnisse, das die bisweilen hysterische Feindseligkeit gegenüber Israel erkläre. "Europa sieht die Intifada als einen lokalen Konflikt - mächtige Israelis greifen schwache Palästinenser unter militärischer Besatzung an. Die meisten Israelis hingegen sehen sich selbst unter Belagerung in einem Meer von arabischen Muslimen, deren Speerspitze - die Palästinenser - gegen sie gerichtet ist." Bei der Suche nach den Gründen, warum gerade Europa sich so schwer tut, Israels Dilemma zu verstehen, spielen die jeweils eigene Geschichte und Gegenwart eine wichtige Rolle. Wer im Nahen Osten Stellung bezieht, redet immer auch über sich selbst. In der Schweiz zum Beispiel, wo sich der Tonfall drastisch verschärft hat, geben hohe Beamte unumwunden zu, dass in die Israelkritik eine verspätete Rache für die jüngsten Enthüllungen über die schlafenden Konten mit einfließt. In Deutschland wiederum empfindet so mancher Kritik an Israel als Entlastung für die eigenen Verbrechen an den Juden. "Während in Deutschland der Sinn für nationale Schuld Anzeichen von Schwäche zeigt, hat in Schweden, Norwegen und Dänemark die politische Korrektheit die Unterstützung für Israel verdrängt," schreibt Eliahu Salpeter in Haaretz. Er glaubt, dass Israel zudem auch unter europäischem Antiamerikanismus leidet. "Ein vitales Israel wird als ein Mikrokosmos der amerikanischen Erfolgsgeschichte wahrgenommen, der zugleich beneidet und verachtet wird." Es sei leichter, Kriegsverbrechen in Dschenin als in Kandahar anzuklagen. Es ist das alte Lied der Linken, die Israel gern als vorgeschobenen Flugzeugträger des US-Imperialismus im Nahen Osten sehen. Der Chefredakteur der Jerusalem Post, Bret Stephens, sucht die Ursachen für Europas Kritik an Israel im Streben nach moralischer Makellosigkeit als Kompensation für fehlende Macht. In Stephens' Augen bedeutet europäische Außenpolitik heute kaum mehr als eine Kombination aus humanitärer Hilfe, Konfliktlösungsbemühungen und leeren Forderungen nach dem Ende des Hungers auf der Welt. In Bezug auf Israel habe diese Tugendhaftigkeit klare Konsequenzen: "Aus europäischer Sicht ist palästinensischer Terrorismus zwar falsch, aber Israel hat kein Recht auf Selbstverteidigung. Wenn wir wirtschaftliche Blockaden errichten, um Attentäter draußen zu halten, werden wir beschuldigt, die Unschuldigen zu bestrafen. Aber wenn wir eine Politik der gezielten Tötung praktizieren, bezichtigt man uns der außergerichtlichen Exekutionen." Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die Verständnis für Selbstmordattentäter äußern, weil sie als "Befreiungskämpfer" gelten. Nach dem Motto: Wie sollen die Palästinenser denn sonst ihre Ziele erreichen? Der französische Sozialist François Zimmeray, Mitglied des europäischen Parlaments, erinnert an die Konferenz über Rassismus im südafrikanischen Durban, 2001, auf der zahlreiche NGOs gegen Israels staatliche Existenz Front machten. Er warnt vor dem "Durbanisierungs-Prozess": "Israels Isolation ist der Auftakt zum Verlust seines moralischen Status, was zu einer Neubewertung des Rechts der Juden auf Selbstbestimmung führen könnte." Die Angst, dass der jüdische Staat international infrage gestellt werden könnte, treibt die Israelis um, wenn sie die Kritik aus Europa hören. Die Zeit 13.6.2002