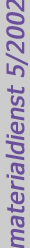Wissen um die eigene Religion entscheidend für die Zukunft
von Moritz Neumann
Nichts ist mehr, wie es einmal war. In Hessen gab es während der ersten Jahrzehnte des mittlerweile vorigen Jahrhunderts rund 350 Jüdische Gemeinden. Heute sind es gerade mal zehn. Verschwunden, nein: zerstört und vernichtet, sind Menschen und Gotteshäuser. Was oftmals und vielerorts geblieben ist, sind allmählich verblassende Erinnerungen. Nicht selten auch verdrängte Erinnerungen. In Hessen wurde in diesem Jahr, zusammen mit dem Tag des Denkmals, ein Tag der jüdischen Kultur begangen. Nicht direkt am selben Tag, sondern um eine Woche vorverlegt, weil am 8. September Rosh Haschana beginnt, das jüdische Neujahr, und weil dies bei der Planung zunächst übersehen worden war. Jüdisches Leben und seine religiösen Erfordernisse sind hier zu Lande nur unzureichend ins alltägliche Bewusstsein zurückgekehrt. Auch im Jahr 2002 ist ein Tag der jüdischen Kultur noch immer und vor allem ein Blick zurück, eine Erinnerung an jüdisches Leben, wie es früher einmal existiert hat, vor der Nazi-Zeit, früher, als alles noch besser war, als jüdisches Leben aus sich heraus zu existieren vermochte, und nicht angewiesen war auf die lebenserhaltenden Vitalspritzen der öffentlichen Hand. Also ist der Tag der jüdischen Kultur vornehmlich und zwangsläufig ein Ereignis, das auf steinerne Zeugen mehr zurückgreifen muss denn auf lebendige. Auf die rund 350 jüdischen Friedhöfe im Lande, auf ehemalige, inzwischen zweckentfremdete Synagogen und nicht ganz zwei Handvoll noch oder wieder ihrem zugedachten Zweck dienende Gotteshäuser. Nichts macht die Situation deutlicher als die Zahl der jüdischen Friedhöfe: 350, verteilt auf das Bundesland. Überall dort, wo heute noch ein jüdischer Friedhof besteht, existierte bis in die 30er Jahre auch eine Jüdische Gemeinde. Von ihr ist in den meisten Fällen nichts geblieben: die Synagogen zwangsverkauft oder enteignet, zu Wohnquartieren der Arisierer, zu Werkstätten oder Ställen umgewandelt, die Menschen vertrieben, deportiert oder ermordet, sind allein die Begräbnisstätten und deren vom Regen vielfach ausgewaschene Grabsteine als (be-)greifbares Zeugnis einstiger blühender Existenz geblieben. Und doch gibt es da plötzlich diesen Wandel, unerwartet und unvorbereitet eingesetzt. Jüdische Gemeinden, die spürbar in die Endphase ihrer Existenz geraten waren, die ausgezehrt und mittellos nach spätestens zwei Generationen von der Karte jüdischen Lebens verschwunden gewesen wären, die in den meisten Fällen eben nichts anderes waren als die "Sheerit ha Pleita", die geretteten Reste, sind urplötzlich in eine neue Wirklichkeit versetzt worden: die Zuwanderung jüdischer Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion eröffnet ihnen eine neue Chance und entwickelt sich womöglich zur alles entscheidenden Frischzellenkur für das jüdische Leben in Deutschland entwickelt. Die Zahl der in Hessen lebenden jüdischen Menschen hat sich im Laufe von zwölf Jahren auf annähernd 13 000 verdoppelt. Diese Zahl erhält ihre Bedeutung durch die Veränderung der Situation in den Jüdischen Gemeinden, vor allem in den kleinen Gemeinden. In Frankfurt ist die Situation schon deshalb anders, weil die Mainmetropole stets eine Besonderheit unter den Jüdischen Gemeinden bildete, vor und nach der Nazi-Zeit immer die zweitgrößte nach Berlin war, mit rund 30 000 Mitgliedern vor 1933, und nurmehr 4500 danach. Im übrigen Land Hessen indessen war der Niedergang spürbarer, denn von den zahlreichen so genannten einstigen Landgemeinden waren nicht einmal zehn wieder entstanden, zusammen nicht mehr als 1500 Menschen. Wie sehr hier die Zuwanderung der Emigranten eine Veränderung herbeigeführt hat, lässt sich besonders deutlich an der Jüdischen Gemeinde Kassel erkennen: in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren eine familiäre Klein-Gemeinde von nicht mehr als 70 Mitgliedern, zählt man im Raum Kassel heute mehr als 1000 Gemeindemitglieder. Doch Zahlen sind nur die eine Seite der Medaille. Entscheidend für die Lebensfähigkeit in der Zukunft sind das Wissen um die eigene Religion, um ihre Inhalte und Traditionen, und die Bereitschaft, als selbstbewusste Angehörige einer religiösen Minderheit zu existieren. Da aber ist der Nachholbedarf gewaltig. Denn die Mehrzahl der Emigranten, die aus Russland und der Ukraine, aus Moldawien oder dem Baltikum nach Deutschland kommen, wissen allenfalls, dass sie auf dem Papier "Ewrei" sind, Juden. Und sie haben die Erfahrung machen müssen, dass sie in ihrer einstigen Heimat mit dem entsprechenden Eintrag im Pass nicht gerade ein Glückslos gezogen hatten. Die praktizierte Religionsfeindlichkeit des Sowjet-Regimes, zusammen mit einem anhaltenden und von den Behörden zumindest sanktionierten Antisemitismus, wirkt nach - und auf die Jüdischen Gemeinden und ihren kleinen Kreis der zumeist ehrenamtlich Tätigen kommt unversehens eine Aufgabe zu, bei der die Unzulänglichkeit beinahe vorprogrammiert ist: nämlich die Zuwanderer zu aktiven Mitgliedern der Gemeinden zu machen, sie von Juden auf dem Papier zu überzeugten, bewussten und mit ihrer Religion vertrauten Neu-Bürgern zu wandeln. Die Anstrengungen, die überall gemacht werden, sind beträchtlich und die Resultate - trotz allem - respektabel. Doch ohne die Hilfe von Land und Kommunen kommt bis auf weiteres keine Jüdische Gemeinde aus. Das Land Hessen zeigt sich den Nöten der Jüdischen Gemeinden gegenüber aufgeschlossen. Aber da sind auch jene Städte, in denen sich das Verständnis auf bloße verbale Deklamationen reduziert, möglichst an den Tagen, da der brennenden Synagogen oder der Deportationen gedacht wird. Mehr ist manchmal nicht zu erwarten. Wenn es um Jüdische Gemeinden geht, sprechen Politiker gern von Normalisierung, und sie meinen damit: Schluss mit den "besonderen Beziehungen". So wie jener Stadtverordnete, der wohl nur zufällig der FDP angehörte, es im Vorfeld des vorwiegend städtisch finanzierten Synagogenbaus in Darmstadt vor rund 15 Jahren gesagt hatte: "Dem Projekt stimmen wir zu - aber dann, bitteschön, wollen wir Normalisierung." Der Autor ist Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen.Frankfurter Rundschau, 30.8.2002