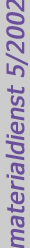Russen und Reformer
Eine Reise durch die jüdischen Gemeinden Deutschlands im Schatten des Nahostkonflikts
von Jan Ross
Mitte April, als die Welle der palästinensischen Selbstmordattentate ihren Höhepunkt erreicht hatte und Ministerpräsident Scharon seine Gegenoffensive ins Westjordanland unternahm, veranstaltete der Zentralrat der Juden in Deutschland vor der Frankfurter Paulskirche eine Solidaritätsdemonstration für Israel. Ton und Atmosphäre zeugten von einer neuen Besorgtheit und Anspannung, Rednerliste und Szenerie auf dem Podium aber hätten vor zehn oder zwanzig Jahren kaum anders ausgesehen: Es sprachen Vertreter der örtlichen Jüdischen Gemeinde und der Stadt, der Zentralratsvorsitzende und der israelische Botschafter, Bundespolitiker von Regierung und Opposition. Wer jedoch nicht nur auf die Bühne achtete, sondern auf die Teilnehmer der Kundgebung, dem musste an einem unverkennbaren Detail auffallen, wie fundamental sich die Situation der jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik seit der europäischen Zeitenwende um 1990 verändert hat. Die Sprache nämlich, die man an diesem Nachmittag auf dem Paulsplatz vor allem hörte von den Demonstranten mit ihren blau-weißen israelischen Fahnen und ihren Transparenten gegen den Terror - diese Sprache war Russisch. Als die Sowjetunion zerfiel, öffneten sich auch die Grenzen für die von den Behörden jahrzehntelang zurückgehaltene oder im politischen Pokerspiel instrumentalisierte jüdische Emigration. Die weitaus meisten Auswanderer gingen nach Israel, viele in die Vereinigten Staaten, mehrere zehntausend aber auch in die Bundesrepublik, die als einziges Land außer Israel die Tore offen hielt. So ist die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinden in Deutschland bis Ende 2001 auf knapp 94 000 gestiegen (und nicht alle Eingereisten melden sich bei den Gemeinden an); zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung hatten in der Bundesrepublik keine 30 000 Juden gelebt und in der DDR nur wenige Hunderte. Der Zuwachs ist ohne Parallele in irgendeiner anderen europäischen Diasporagemeinschaft, die allesamt schrumpfen - so sehr, dass der dauerhafte Fortbestand des Judentums in Europa fraglich ist. Repräsentanten der Ermordeten Die Probleme der Zuwanderung sind einerseits dieselben wie bei jeder Migration: Sprache, Wohnungen, Arbeitsplätze, Sozialkontakte. Aber die "Neuen" sollen nicht nur in die deutsche Gesellschaft insgesamt integriert werden, sondern auch in die jüdischen Gemeinden. Und was immer für Juden in der alten Bundesrepublik kollektiv identitätsbildend war, die Religion, die prekäre Existenz im Land der Täter oder die materielle und moralische Unterstützung für Israel - das alles stellt sich aus der Sicht der Einwanderer anders dar oder hat zunächst überhaupt keine selbstverständliche Bedeutung. Der Vielvölkerstaat Sowjetunion definierte das Judentum ethnisch, als Passvermerk unter der Rubrik "Nationalität", und war eine Gesellschaft des offiziösen Atheismus; kein Wunder, dass die meisten, die von dort kommen, religionsfern denken und leben. Aber auch die historischen Bezugspunkte sind vielfach andere. Judith Kessler, die das Gemeindemagazin Jüdisches Berlin redigiert und auch als Sozialwissenschaftlerin über die Zuwanderung gearbeitet hat, beschreibt den befremdeten Alteingesessenenblick auf die Geschichtskultur exsowjetischer Weltkriegsveteranen so: "Was will der denn? Jetzt läuft er hier mit seinen Orden herum. Er feiert den 8. Mai, aber zur Gedenkveranstaltung am 9. November kommt er nicht." Gerade war er wieder, der 8. Mai, und während sich die Augen der einen skeptisch bis bestürzt auf das Nationalgespräch zwischen Gerhard Schröder und Martin Walser richteten, begingen die anderen den Tag des Sieges über Hitler im Großen Vaterländischen Krieg. Die nichtjüdische Öffentlichkeit, die deutsche "Mehrheitsgesellschaft", wie es auf Soziologisch heißt, nimmt das Judentum hierzulande vornehmlich folkloristisch (Klezmer) oder, dies vor allem, institutionell wahr, in einer erwünschten oder lästigen Mahn- und Expertenfunktion zu politisch-moralischen Fragen vom Alltagsrassismus bis zum Nahostkonflikt. Das Interesse an dieser winzigen Minderheit und die ihr zugedachte Rolle hängen unmittelbar mit Schuldbewusstsein und Wiedergutmachungswünschen zusammen; Julius H. Schoeps, der in Potsdam lehrende Historiker der deutsch-jüdischen Geschichte, sagt es hart und treffend am Beispiel der Gemeindevertreter in den Rundfunkräten öffentlich-rechtlicher Sender: "Sie sitzen da nicht als Repräsentanten der 100 000 lebenden, sondern von sechs Millionen ermordeten Juden." Die Erinnerung an den Holocaust ist für die Existenz, das Selbstverständnis und das Fremdbild von Juden überall auf der Welt eine prägende Wirklichkeit; es bleibt unvorstellbar, dass sie ausgerechnet in Deutschland in irgendeiner künftigen "Normalität" ihre Bedeutung verlieren sollte. Nur ist die Vergangenheit nicht die einzige Bestimmungsgröße für die jüdische Gegenwart in der Bundesrepublik. Ebenso wenig ist es das antijüdische Ressentiment, das sich gegenwärtig bemerkbar macht, zwischen Israelkritik und Antisemitismus chamäleonhaft changierend, und das in den Stellungnahmen der Offiziellen im Vordergrund steht. Der Zuzug aus der einstigen Sowjetunion ist eine vollkommen neuartige, in ihren Dimensionen beispiellose Herausforderung - wie sehr, das macht die Zahl von 235 000 Einreiseanträgen deutlich, die auf ihre behördliche Erledigung warten. Das Mitgliederwachstum löst in den Gemeinden Überwältigungsängste ebenso wie Erneuerungshoffnungen aus. Und da die meisten Zuwanderer säkular sind, stellt sich auch durch sie noch einmal eine Frage, von der die religiös bewussten und interessierten Juden in Deutschland ohnehin stark umgetrieben werden bis hin zu heftigem Streit und Zerwürfnissen: die Frage nach dem religiösen Pluralismus, nach der Herausforderung der bislang vorherrschenden Orthodoxie durch liberale und reformjüdische Konkurrenz. Unter den deutschen Juden der Zeit vor 1933 war die liberale, von der Aufklärung beeinflusste Richtung stark vertreten. Aber nur sehr wenige von ihnen haben die Verfolgung im Versteck überlebt oder sind aus dem Exil zurückgekehrt. Ganz überwiegend wurden die Nachkriegsgemeinden von ehemaligen Displaced Persons aufgebaut, osteuropäischen Juden, die nach Deutschland als Zwischenstation auf dem Weg nach Israel oder Amerika kamen - einige wenige blieben. Die religiöse Überlieferung, die sie mitbrachten, war die traditionelle Gesetzestreue und Frömmigkeit der zumal polnischen Kerngebiete des europäischen Judentums. Sie ist im Großen und Ganzen in der Bundesrepublik maßgebend geblieben, das Bild von Gemeinde und Synagoge prägend auch bei jenen, die persönlich keineswegs streng oder auch nur ungefähr nach den religiösen Vorschriften leben; Andreas Nachama, von 1997 bis 2001 Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Berlin und selbst als Rabbiner ein amerikanisch inspirierter Neuerer, beschreibt die dominierende Mentalität als "non observing orthodox". Diese Routine wird nun in Zweifel gezogen - von Intellektuellen, die die Kombination von religiösem Konservativismus und religiöser Gleichgültigkeit unbefriedigend finden; von Frauen, die mehr Teilhabe fordern bis hin zur Anerkennung des weiblichen Rabbinats. Nur darf man sich, wie auch im Christentum, das Gegeneinander von Fortschritt und Beharrung nicht zu simpel vorstellen. Jung, weiblich, gebildet, russische Herkunft: Das müsste, wenn überhaupt an Religion interessiert, nach Schema X eine typische Reformerin erwarten lassen. Und dann ist da Viktoria Dolburd, die an der Spitze des Jüdischen Studentenverbands steht, und will von Rabbinerinnen gar nichts wissen und spricht mit Vergnügen von den jungen Orthodoxen in New York, die am Sonnabend selbstverständlich den Sabbat halten und sich am Sonntag ebenso selbstverständlich in der Disco amüsieren. Eine Wende- und Übergangszeit. Salomon Korn, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, meint, dass sich die ganze Frage nach einem deutschen Judentum noch einmal neu stelle - ob es möglich sei und was es eigentlich bedeuten solle. Vor 1989 gab es, bei aller quälenden Problematik und Fragilität des Lebens unter einstigen Nazis und Mitläufern, eine Art Übereinstimmung von innen und außen: "Das Provisorium, das die Bundesrepublik war, entsprach dem Provisorium der eigenen Existenz; die Zerrissenheit des Landes und die persönliche Zerrissenheit spiegelten einander." Mit der deutschen Einheit war das vorbei; man musste sich zu der nun etablierten Dauerhaftigkeit der neuen Bundesrepublik irgendwie verhalten. Korn glaubt, dass Ignatz Bubis einer Illusion unterlag, als er geradewegs zu einer deutsch-jüdischen Normalität durchstoßen wollte, mit der Formel: "Ich bin ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens." Er selbst reagiert anders, wenn er wieder einmal auf "seinen" Botschafter angesprochen wird und damit der israelische gemeint ist: "Ich empöre mich nicht. Ich biedere mich auch nicht an; ich versuche, herauszubekommen und zu verstehen, was da los ist." Den Weg zur Normalität schätzt Korn auf vier Generationen - also bis zu den Urenkeln von Tätern und Opfern. Und er meint, dass sich im Rückblick von heute, aus der Distanz, die deutsch-jüdische Geschichte der Zeit vor 1933 anders ausnimmt als in der Nachkriegsbundesrepublik. Das Wachstum der Gemeinden durch die russischen Einwanderer, das Sichregen der Reformkräfte, das zunehmend freundliche Interesse etwa amerikanischer Juden an den deutschen - das alles könnte immerhin die lange verbreitete Einschätzung revidieren helfen, dass das bürgerliche, liberale Judentum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland von vornherein auf einem schrecklichen historischen Irrweg war, verblendet, und dass alles notwendig in Auschwitz enden musste. Die Juden in Deutschland sind keine Parias mehr in der jüdischen Welt. Das American Jewish Comittee hat sein Europabüro in Berlin eingerichtet. Schimon Stein, der israelische Botschafter, pflegt ein entspanntes Verhältnis zum Zentralrat. Die Gegenwehr gegen eine judenfeindliche Sicht des Nahostkonflikts verbindet, und der spezifische Faktor "Deutschland" trennt nicht; Antisemitismus scheint heute weit mehr ein europäisches als ein besonderes deutsches Phänomen zu sein. Stein denkt nicht daran, noch einmal Grundsatzdiskussionen darüber zu eröffnen, ob Juden überhaupt in Deutschland leben sollten: "Das hat sich erledigt. Wir sind ein Volk, wir werden als Einheit wahrgenommen, in Israel und in der Diaspora, und aus der Perspektive des jüdischen Volkes hat es keinen Sinn, Juden auszugrenzen." Schockerlebnis Golfkrieg Es gibt, bemerkt Stein, allerdings einen großen Unterschied zwischen den Einwanderern hier und in Israel, was ihre Integration ins Judentum angeht - also nicht einfach in irgendeine Umgebungsgesellschaft. Israel ist der jüdische Staat; wie fromm oder säkular seine jüdischen Bürger auch sein mögen, sie sind einbezogen in diese Gemeinsamkeit, die sich politisch und alltäglich manifestiert: "Für die jüngeren Immigranten ist die Armee der Schmelztiegel, für alle zusammen ist es die Erfahrung des Bedrohtseins." In Deutschland dagegen, wie überhaupt in der Diaspora, kommt es zur Identifikation viel stärker auf die Religion an. Gerade sie aber ist den Zuwanderern oft ausgesprochen fremd. Was aus der Palästinakrise noch folgen kann, ist schwer zu sagen. Julius Schoeps nennt die aktuelle Lage "brandgefährlich" und die längerfristige Zunahme des Antisemitismus "extrem" - von der seit 1990 verdreifachten Häufigkeit von Friedhofsschändungen bis hin zu vergifteten Bemerkungen, die er an seiner Universität zu hören bekommt. Für Micha Brumlik, Erziehungswissenschaftler in Frankfurt und Direktor des Fritz Bauer Instituts für Holocaust-Studien, war das Schock- und Klärungserlebnis der Golfkrieg von 1991, als ihn der proarabische und antiwestliche Pazifismus der Linken entsetzte und zum Austritt aus den Grünen trieb. Damit verglichen, gehen ihm die gegenwärtigen Debatten und Sorgen weniger nahe: "Mein Herz blutet nicht mehr wie damals." Brumlik macht es traurig, wenn heute 20-jährige Juden in Deutschland wieder Antisemitismus erfahren - aber sagen die Statistiken nicht doch, dass die Vorurteile über die Jahrzehnte geschwunden sind? Ihm jedenfalls scheint, "dass mit der Zeit dieses deutsch-jüdische Thema sich historisiert". Er würde auch Bubis zustimmen, vielleicht nicht in der später enttäuschten Normalitätshoffnung, wohl aber mit der Selbstbeschreibung als deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens: "Natürlich bin ich deutscher Staatsbürger. Aber ein ethnischer Deutscher bin ich nicht." Und dann nennt Micha Brumlik ein sehr einfaches und einleuchtendes Beispiel dafür, wo das Deutschsein für ihn aufhört. Es ist der Volkstrauertag. "Da bin ich ganz entschieden nur Betrachter."Die Zeit, 16.5.2002