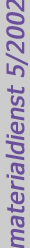Es geht um Land, nicht um Religion
Empfehlungen zur Eindämmung des Nahost-Konflikts
von Volker Perthes
Zur Lösung des Nahost-Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern ist ein internationales Engagement notwendig, urteilt Volker Perthes. Wie dies aussehen, wer daran beteiligt und welche Grundlagen es haben sollte, hat er in einem Beitrag für die Blätter für deutsche und internationale Politik (August-Heft), Blätter Verlagsgesellschaft Bonn, skizziert. Wir dokumentieren seine Analyse gekürzt. Der Autor ist Projektleiter der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. (. . .) Palästinenser und Israelis sind, derzeit zumindest, nicht in der Lage, ihren Konflikt allein beizulegen (. . .). Das liegt am völligen Vertrauensverlust beider Seiten in die jeweils andere und an der asymmetrischen Verteilung von Macht und militärischen Möglichkeiten, die sowohl in den Selbstmordanschlägen der letzten Monate wie auch in der Besetzung des größten Teils der palästinensischen Gebiete zum Ausdruck kommt. Trotz Vertrauensverlusts und Konfrontation gibt es allerdings in beiden Gesellschaften, der israelischen und der palästinensischen, eine wieder wachsende Einsicht in die Notwendigkeit, eine politische Lösung zu finden. Ein internationales Engagement ist also nicht nur notwendig, sondern stößt auch bei großen Teilen der israelischen und palästinensischen Bevölkerung auf Zustimmung. Was aber haben europäische und amerikanische Akteure zu beachten, wenn sie den Friedensprozess im Nahen Osten wieder in Gang setzen wollen? (. . .) Von der Vision zur Blaupause Eine der vielleicht wichtigsten Lehren aus dem Oslo-Prozess lautet: Ein wiederbelebter Friedensprozess muss den Beteiligten klare politische Perspektiven bieten. Die "Vision" des US-Präsidenten, dass es am Ende zwei Staaten, Israel und Palästina, geben werde, die friedlich nebeneinander leben, ist hilfreich, reicht aber nicht aus. Gebraucht wird vielmehr eine detaillierte Blaupause mit Lösungen für die so genannten Endstatus-Themen. Das ist keineswegs unmöglich: Die Konturen einer beidseitig mehrheitlich akzeptablen Lösung sind bekannt. Sie gehen vor allem aus den Clinton-Vorschlägen vom Dezember 2000 und aus dem Acquis der Verhandlungen von Taba im Januar 2001 hervor, die EU-Nahost-Botschafter Moratinos zusammengetragen hat. Diese umfassen unter anderem die Entstehung eines palästinensischen Staates, dessen Grenzen mit Israel im Wesentlichen den Linien von 1967 entsprechen, einige Grenzkorrekturen, die Räumung der meisten jüdischen Siedlungen in Westbank und Gaza-Streifen, die Annexion einiger größerer Siedlungen und den entsprechenden Tausch von Territorium mit dem zukünftigen Staat Palästina sowie die politische Teilung Jerusalems, wobei West-Jerusalem erstmals international als Hauptstadt Israels anerkannt und Ost-Jerusalem zur Hauptstadt Palästinas wird. Den palästinensischen Flüchtlingen und Vertriebenen wird eine "Rückkehr" in den neuen Staat Palästina, nur in sehr begrenztem Maße aber eine Rückkehr in ihre Ursprungsorte im heutigen Staatsgebiet Israels ermöglicht. Beide Seiten erklären zudem ein "Ende des Konflikts": Damit verdeutlicht vor allem die palästinensische Seite, dass sie keine weiter gehenden Ansprüche formuliert, die Entstehung des Staates Palästina in den 1967er Grenzen also nicht als Etappenschritt auf dem Weg zur arabischen Übernahme Israels, sondern als das endgültige Ergebnis des arabisch-israelischen Konflikts und Friedensprozesses betrachtet. Es wird wohl das Quartett (Vereinte Nationen, Russland, EU, USA; d. Red.) sein müssen, mindestens jedoch die USA und die EU, die eine solche Blaupause vorlegen. Das ist aus mehreren Gründen notwendig. So werden Israelis und Palästinenser bestimmte Zugeständnisse, die ein Friedensabkommen erfordert, eher einer dritten Partei als dem jeweiligen Gegner gegenüber zu machen bereit sein. Das gilt insbesondere, wenn diese dritte Partei mit einer einheitlichen Position auftritt und deutlich macht, dass die lokalen Akteure den Inhalt ihrer Vorschläge entweder akzeptieren oder ablehnen können. Im ersten Fall, dies müsste klar gemacht werden, würden die USA und die Europäische Union ihnen volle Unterstützung gewähren - ökonomische Aufbauhilfe ebenso eingeschlossen wie mögliche Sicherheitsgarantien für Israel und einen palästinensischen Staat, der keine eigene Armee unterhalten wird. Wenn die lokalen Parteien die internationale Blaupause hingegen ablehnen, sollten sie nicht mehr mit internationaler Unterstützung rechnen können. Eine solche Blaupause ist schließlich auch notwendig, weil sie eine weitere Debatte in beiden Gesellschaften, der palästinensischen und der israelischen, auslösen kann. Die verschiedenen politischen Kräfte müssten sich dann entsprechend ihrer unterstützenden oder ablehnenden Haltung gegenüber dem internationalen Vorschlag positionieren. Eine zweite Lehre aus dem Oslo-Prozess: Es ist unerlässlich, zukünftig einen klaren Zeitrahmen vorzugeben. Der quasi-permanente Interimsstatus in den Jahren seit dem Oslo-Abkommen von 1993 hat viel zu der Frustration beigetragen, aus der sich die Intifada nährt. Der Interimszustand führte auch nicht, wie die Väter von Oslo wohl glauben mochten, zum graduellen Vertrauensaufbau zwischen den beiden Parteien. Im Gegenteil, das Misstrauen ist gewachsen: Israelisches Misstrauen, dass die Palästinenser eigentlich keinen Frieden mit Israel wollen, sondern einen eigenen Staat in den noch israelisch besetzten Gebieten lediglich für die Fortsetzung des Konfliktes und weiter gehende Forderungen nach Territorium des Staates Israel nutzen würden; palästinensisches Misstrauen, dass die israelischen Regierungen die besetzten Gebiete nicht wirklich aufgeben, sondern die Interimsphase nur nutzen wollen, um ihre Herrschaft über diese Gebiete durch die Schaffung immer weiterer Facts on the Ground - besonders den weiteren Bau von Siedlungen und Siedlerstraßen - zu festigen. Vollständig brach das Vertrauen nach dem Ausbruch der anhaltenden, blutigen Feindseligkeiten im September 2000 zusammen. Der Zeitraum von drei Jahren, den Präsident Bush in seiner Rede für die Entstehung eines palästinensischen Staates vorgibt, dürfte gerade noch praktikabel sein, obwohl er sich zunächst am amerikanischen Wahlkalender orientiert: Er stellt, ohne es explizit zu sagen, in Aussicht, dass Bush sich nach einer Wiederwahl im Jahre 2004 ohne wahlpolitische Rücksichtnahmen um die Lösung des Nahost-Konflikts kümmern werde. Der benannte Zeitrahmen basiert aber auch auf der Erkenntnis, dass es vor den derzeit für Ende 2003 vorgesehenen israelischen Wahlen keine substanziellen Fortschritte im israelisch-arabischen Friedensprozess geben wird. Denn auch die Bush-Administration weiß - sosehr sie den palästinensischen Präsidenten Yassir Arafat für die katastrophalen Entwicklungen der letzten Monate verantwortlich macht -, dass Israels Ministerpräsident Ariel Scharon nicht der Mann ist, der Israel zum Frieden mit seinen Nachbarn führen wird. Scharons Vorstellungen einer Lösung, bei der den Palästinensern weniger als die Hälfte der Westbank verbliebe und keine jüdische Siedlung aufgelöst würde, können von arabischer Seite nicht als Friedensangebot verstanden werden. (. . .) Zum Umgang mit Israel Gerade wenn Europa eine deutlichere Rolle im Nahen Osten spielen oder stärker auf amerikanische Nahost-Politik Einfluss nehmen will, muss es sich bemühen, immer wieder die schwierige Balance zu verdeutlichen, die europäische Politik gegenüber Israel erfordert: dass nämlich die Sicherheit Israels prioritäres Ziel europäischer Außenpolitik bleibt, gleichzeitig aber Israels eigene Definition oder Konzeption von "Sicherheit" nicht einfach übernommen werden kann. Die Europäische Union hat mehr als einmal betont, dass ein lebensfähiger palästinensischer Staat auch die beste Garantie für die Sicherheit Israels darstelle. Israel kann Frieden und Sicherheit eben nur erreichen, wenn es auch den Palästinensern zugesteht, ihr Schicksal in einem eigenen Staat selbst zu bestimmen. Die oft in Frage gestellte Friedensbereitschaft der Palästinenser, wie auch die der arabischen Staaten insgesamt, lässt sich an vielerlei Dingen messen: an ihrer Bereitschaft zur Aufnahme normaler Beziehungen mit Israel und zur Integration Israels in die regionale Staatengemeinschaft etwa oder an der Bereitschaft, den zukünftigen palästinensischen Staat weitestgehend zu demilitarisieren. Die Friedensfähigkeit Israels misst sich an seiner Bereitschaft, die besetzten arabischen Gebiete aufzugeben. Europa und die internationale Gemeinschaft müssen aber mehr tun, als israelische oder palästinensische Konzessionen zu verlangen. Sie werden sich nicht zuletzt überlegen müssen, was uns der Friede im Nahen Osten, der immer mal wieder als "vitales" europäisches Interesse bezeichnet wird, eigentlich wert ist. Sind wir etwa bereit, einen israelisch-palästinensischen Friedensschluss und einen umfassenden israelisch-arabischen Frieden durch ein, sagen wir, 100 Milliarden Euro schweres Entwicklungsprogramm, einen echten Marshall-Plan für den Nahen Osten, zu honorieren, der analog zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundstrukturen schafft, die ein stabiler Friede braucht? Wären wir darüber hinaus bereit, einen israelisch-palästinensischen Frieden zu unterstützen, indem wir beiden Staaten eine Mitgliedschaft in der OSZE, in der Nato oder eine engere EU-Assoziation (eher dem heutigen Status der Schweiz als dem der Türkei entsprechend) anbieten - vielleicht sogar einen EU-Kandidatenstatus in Aussicht zu stellen? All dies mag zum heutigen Zeitpunkt weitreichend, wenn nicht absurd erscheinen. Es verweist uns aber darauf, dass Europa eine eigene Verantwortung für den Friedensprozess im Nahen Osten trägt und dass es über materielle, politische und symbolische Ressourcen und Mittel verfügt, die in seinen Dienst gestellt werden können. Diese sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Zum Umgang mit Palästina Es steht außer Frage, dass es einer Reform der palästinensischen politischen Strukturen bedarf. Die Palästinenser verdienen Demokratie, eine bessere Regierungsführung (good Governance), eine verantwortliche und transparente öffentliche Verwaltung und die Wahrung ihrer Grundrechte genauso wie die Israelis und jedes andere Volk. Es gibt auch keinen Grund, Menschenrechtsverletzungen damit zu entschuldigen, dass die Situation so schwierig sei oder dass man sich in einer brutalen Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Gegner befinde. Die Forderung nach einer Demokratisierung der palästinenischen Autorität ist legitim. Allerdings ist sie nicht ganz so neu, wie es in der Bush-Rede schien. Sie wird, das ist wohl das Wichtigste, von einem großen Teil der Palästinenser unterstützt. Wenn Europa und die USA Reform und Demokratisierung der palästinensischen Institutionen tatsächlich fördern wollen, dann stellen sich auch ihnen einige Aufgaben. Zuerst einmal müssen die Palästinenser überhaupt eine Chance erhalten, Reformen durchzuführen und Governance zu praktizieren. (. . .) Die Wiedererrichtung palästinensischer Institutionen und, mehr noch, die Durchführung freier und fairer Wahlen wird ohne eine Wiederherstellung der Bewegungsfreiheit der palästinensischen Bürger und Bürgerinnen nicht möglich sein. Dazu aber müssen die israelischen Truppen sich zumindest auf die Positionen zurückziehen, an denen sie vor dem Beginn der Intifada im September 2000 standen. Ein solcher Rückzug darf nicht erst dann stattfinden, wenn die Palästinensische Autonomiebehörde sich selbst reformiert hat, er ist vielmehr eine von mehreren Reformbedingungen. Denn wie sollen sich neue politische Kräfte formieren können, wie alternative Präsidentschaftskandidaten gar ihre Kampagnen organisieren, wenn sie sich allenfalls mit israelischen Passierscheinen von der Westbank in den Gaza-Streifen oder selbst von Nablus nach Ramallah oder von Hebron nach Jerusalem bewegen können? Reform und Demokratisierung können also, so wichtig sie sind, nicht Voraussetzung für die Umsetzung israelischer Verpflichtungen sein. Die israelische Regierung hat, um es milde zu sagen, wenig getan, um den Aufbau verantwortlicher palästinensischer Institutionen zu unterstützen. Die Regierung Scharon nutzt die Forderung nach palästinensischen Reformen heute ein wenig so wie im letzten Jahr die nach "sieben Tagen absoluter Ruhe": als eine schwer oder gar nicht erfüllbare Vorbedingung für neue politische Verhandlungen, auf die man sich eigentlich gar nicht einlassen will. Sowenig die Reformforderung als Bedingung israelischer Verhandlungsbereitschaft taugt, sosehr kann Europa und können einzelne EU-Staaten ihre Unterstützung für den Wiederaufbau palästinensischer Regierungsstrukturen konditionieren, also von der Bereitschaft der palästinensischen Akteure, ein transparentes, verantwortliches und demokratisches Regierungssystem aufzubauen, abhängig machen. Gleichzeitig wird die US-Administration, nachdem sie sich darauf festgelegt hat, in Arafat keinen Verhandlungspartner mehr zu sehen und von den Palästinensern eine Abwahl Arafats zu fordern, einige kritische Fragen beantworten müssen. Unterstellen wir einmal, dass ein palästinensischer Politiker auf die Bühne tritt, der eine echte Alternative zu Arafat darstellt und amerikanische Unterstützung verdient - eine Art palästinensischer Hamid Karsai, dem auch die Israelis trauen oder trauen könnten. Glauben wir, dass der von Scharon repräsentierte Teil der israelischen Regierung einem solchen palästinensischen Führer größere Zugeständnisse machen würde als Yassir Arafat? Die israelische Arbeiterpartei und ihr Führer, Verteidigungsminister Benjamin Ben Elieser, würden dies wahrscheinlich tun: Ben Elieser hat selbst einen durchaus überzeugenden Friedensplan vorgelegt. Die israelische Rechte wird aber am größten Teil der besetzten Territorien und an den Siedlungen festhalten wollen, gleich, wer die Palästinenser regiert. Würden die USA, so wird man weiter fragen müssen, einem neuen palästinensischen Führer die Unterstützung geben, die er braucht, um innenpolitisch zu überleben? Würden sie sicherstellen, dass er sich nicht in langwierigen Interimsverhandlungen verbrauchen müsste und seinem Volk keine anderen Ergebnisse zeigen könnte als weitere Siedlungen, weiterhin eingeschränkte Bewegungsfreiheit und weitere Einkommensverluste? Würden die USA genügend Druck auf Israel ausüben, mindestens eine erste, substanzielle Zahl von Siedlungen aufzugeben und die Herausbildung einer neuen palästinensischen Führung mit dem graduellen Abbau weiterer Siedlungen und der Übergabe weiteren Territoriums zu beantworten? Wenn nicht, dann hätte ein palästinensischer Führungswechsel zwar immer noch innenpolitische, innerpalästinensische Bedeutung, aber wenig Bedeutung für den Friedensprozess. Die Rolle der "dritten Partei" Eine dritte Partei, oder richtiger: eine Koalition von willigen internationalen Akteuren, die ihre Kräfte bündeln und koordinieren, um den Friedensprozess wieder auf das Gleis zu setzen und zu Ende zu führen, wird sich nicht auf eine Ratgeber- und Vermittlerposition beschränken können. Sie wird auch mehr als eine diplomatische Rolle spielen müssen. Bundesaußenminister Joschka Fischer hat in seinem Ideenpapier für den Nahen Osten im April 2002 richtigerweise von einem "Sicherheitselement" gesprochen, das die internationale Gemeinschaft - hier wären zunächst das Quartett sowie zwei oder drei arabische Staaten in der Pflicht - zur Verfügung zu stellen haben wird. Die Form und die Aufgaben eines solchen Sicherheitselements sind noch festzulegen; auch über den Grad der internationalen Involvierung werden vor allem die USA und die Europäische Union sich einigen müssen. In jedem Fall kann man davon ausgehen, dass die USA ein solches Sicherheitselement führen und dass das Quartett (oder ein "Quartett plus") eine Art Aufsichts- und Steuerungsfunktion übernimmt. Den geringsten Grad der Involvierung stellte eine multinationale Beobachtergruppe dar, die geschlossene Abkommen und nicht zuletzt die geplanten palästinensischen Wahlen überwacht, an Konfliktpunkten Präsenz zeigt und durch den intensiven Kontakt mit beiden Parteien zur Deeskalation beiträgt. Den Kern einer solchen Gruppe gibt es bereits: Er besteht im Wesentlichen aus amerikanischen und europäischen Geheimdienstleuten und Sicherheitsfachleuten, die versuchen, auf örtlicher Ebene mit den Sicherheitskräften beider Seiten zusammenzuarbeiten. Dazu gehören auch die britischen und amerikanischen "Beobachter" im palästinensischen Gefängnis von Jericho. Um flächendeckend wirksam zu werden, braucht man aber mehrere hundert überwiegend ziviler Beobachter. Das gilt erst recht, wenn bei palästinensischen Neuwahlen die Bewegungsfreiheit von Kandidaten, Wahlkämpfern und Wählern sichergestellt werden soll. Neben dieser Beobachtergruppe wird es, und zwar möglichst bald, eine multinationale Friedens- und Stabilisierungstruppe geben müssen. Dies wird keine UN-Truppe sein, weil Israel den Vereinten Nationen keinerlei Vertrauen entgegenbringt, sondern eine multinationale, von einem starken US-Kontingent geführte Truppe, die kleinere Kontingente einzelner europäischer Staaten sowie möglicherweise ägyptische oder jordanische Einheiten enthält. Sicher ist, dass nur solche Staaten Soldaten entsenden werden, deren Beteiligung beide Seiten, Israelis und Palästinenser, wünschen. Dabei lässt sich nicht ausschließen, dass man auch Deutschland zu einer Beteiligung auffordert. Für die Anwesenheit deutscher Soldaten gibt es sowohl unter Palästinensern wie auch - erstaunlicherweise - unter Israelis viel Sympathie. In Israel kann man immer wieder hören - zweifellos in grundsätzlicher Verkennung der französischen Haltung dem jüdischen Staat gegenüber - dass man lieber ein deutsches als ein französisches Kontingent in einer solchen Truppe sähe. Deutschland selbst darf sich seiner eigenen Geschichte wegen keinesfalls aufdrängen, eine solche Funktion zu übernehmen. Eine Beteiligung abzulehnen, wenn Israelis und Palästinenser dies wünschen, wäre allerdings auch schwierig. Wichtiger als die Zusammensetzung einer multinationalen Friedens- und Stabilisierungstruppe für Palästina ist ihre Aufgabenstellung. Zunächst geht es darum, den Abzug der israelischen Truppen aus den besetzten Gebieten sicherzustellen. Jeder israelische Kontrollpunkt, der abgebaut wird, ist ein Konfrontationspunkt weniger; seine Entfernung erleichtert der palästinensischen Zivilbevölkerung das Leben, erspart ihr die täglichen Demütigungen und reduziert die ständige Reproduktion von Verzweiflung und Hass. Die multinationale Truppe wird auch die illegalen Waffen palästinensischer Milizen einsammeln müssen: Niemand erwartet, dass palästinensische Militante ihre Waffen Israel übergeben. Die Truppe wird mit den palästinensischen Sicherheitskräften zusammenarbeiten müssen, deren Wiederaufbau überwachen und Ausbildungshilfe geben. Dies muss schon beginnen, bevor ein Final-Status-Abkommen besiegelt und umgesetzt ist. Das Mandat der Truppe darf allerdings nicht zu weit gefasst und dadurch unmöglich gemacht werden. Ihre Aufgabe besteht vorrangig darin, Israelis und Palästinenser zu trennen. Darüber hinaus muss sie versuchen, haltbare sicherheitspolitische Kooperationsstrukturen aufzubauen, und sich selbst daran beteiligen. Man kann aber nicht erwarten, dass die multinationale Truppe eine Art Protektorat einrichtet und palästinensischen Institutionen vorsteht. Die palästinensischen Behörden und Sicherheitsorgane gilt es vielmehr zu stärken und in die Lage zu versetzen, die eigenen Angelegenheiten selbst zu verwalten. Die Ministerien der palästinensischen Autonomiebehörde haben, trotz vieler Schwierigkeiten, durchaus bewiesen, dass sie das können. Von einer Friedens- und Stabilisierungstruppe kann und darf auch nicht erwartet werden, dass sie etwa die Räumung jüdischer Siedlungen in der Westbank oder im Gazs-Streifen übernimmt. Dies ist eine israelische Hausaufgabe, die die Behörden und, notfalls, die Armee Israels zu übernehmen haben, bevor letztere sich auf die vereinbarten Grenzen zurückzieht. Wenn ein Friedensabkommen beschlossen ist, beinhaltet das Mandat einer solchen Friedens- und Stabilisierungstruppe auch eine Kontroll- und Überwachungsfunktion an der dann festgelegten israelisch-palästinensischen Grenze und im Jordangraben sowie die Überwachung der Demilitarisierung des zukünftigen Staates Palästina. Für einen klar begrenzten Zeitraum kann diese Truppe auch ein israelisches Kontingent umfassen: Die Palästinenser haben in den Verhandlungen von Taba einer zeitlich begrenzten Anwesenheit israelischer Truppen im Jordangraben prinzipiell bereits zugestimmt. Territorium, nicht Terrorismus In der gegenwärtigen israelisch-palästinensischen und israelisch-arabischen Auseinandersetzung kommt wie bei jedem internationalen Konflikt auch die Macht der Begriffe zum Tragen: Es geht dabei zum Beispiel um die Definition, wer Opfer und wer Aggressor ist, was ein schmerzhaftes Zugeständnis oder ein "generöses Angebot" darstellt oder was eine "gerechte" Lösung bedeutet. Internationale Akteure müssen die Begriffe, mit denen in dem Konflikt operiert wird, mit Vorsicht behandeln. Besonders wichtig ist, sich keiner Täuschung über die Natur, über den essenziellen Charakter des Konflikts hinzugeben und solche Täuschungen auch den öffentlichen politischen Diskurs nicht bestimmen zu lassen. Es geht, konkret, bei diesem Konflikt eben nicht um Terror - worauf die Debatte sich derzeit zu verengen scheint -, sondern um Territorium. Terrorakte, insbesondere Selbstmordanschläge, sind verdammenswerte Mittel der Kriegführung, die nicht akzeptiert werden können. Sie müssen wie (andere) Kriegsverbrechen beurteilt werden. Organisationen wie etwa der palästinensischen Fatah gegenüber sollten gerade Europäer sehr deutlich machen, dass auch legitime Ziele wie die Befreiung des besetzten Territoriums keine illegitimen Mittel rechtfertigen. Arabische Politiker und Intellektuelle, die eine eher unentschiedene, nicht richtig unterstützende, wohl aber apologetische Haltung zum Einsatz terroristischer Mittel einnehmen, sollten sich klar machen, wie sehr die Nutzung solcher Mittel zur moralischen Verwilderung der eigenen Gesellschaften beiträgt. Um dies alles, so wichtig es ist, dreht es sich aber nicht im israelisch-palästinensischen Konflikt. Denn: Der Konflikt ist essenziell ein territorialer Konflikt. Das zeigt sich bei allen Endstatus-Themen: bei der Frage Jerusalems, der Grenzen oder der Siedlungen genauso wie bei der Frage von Wasserrechten und letztlich auch der Flüchtlingsfrage. Scharon und andere rechte Kräfte in Israel streiten den territorialen Charakter des Konfliktes ab, ganz ähnlich übrigens wie militante Islamisten. Wer einen beidseitig akzeptablen Frieden will, darf dagegen nicht vergessen, dass nur die Akzeptanz der territorialen Natur des Konflikts es Anfang der 90er Jahre möglich machte, in ernsthafte Friedensbemühungen einzusteigen - die Akzeptanz, dass Frieden sich über eine territoriale Einigung und die Abgabe okkupierten Landes realisiert, durch "Land für Frieden" eben. Mit dem öffentlichen Eingeständnis beider Seiten, dass es um Land geht - und nicht um prinzipiell unteilbare Güter wie Religion, Ethnizität oder Identität -, beförderte man auch den alten arabisch-nationalistischen Slogan, der arabisch-israelische Konflikt sei kein "Grenzkonflikt, sondern ein Existenzkonflikt" (sira' wujud, la sira' hudud), in den Papierkorb nahöstlicher Geschichte. Es gibt keinen Grund, ihn wieder herauszufischen.Frankfurter Rundschau, 9.8.2002