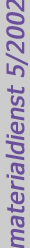Yassir Arafat: Wer ist dieser Mann?
von Uri Avneri und Daoud Kuttab
Seit über 40 Jahren ist Yassir Arafat Symbol des palästinensischen Kampfes für einen eigenen Staat. Immer noch umgibt ihn eine Aura des Rätselhaften. Zwei Journalisten, ein israelischer und ein palästinensischer, die ihm oft persönlich begegnet sind, haben ihn für das Magazin porträtiert. Uri Avnery und Daoud Kuttab zeichnen sehr unterschiedliche Bilder von einem umstrittenen Mann, der zum Mythos geworden ist.Uri Avnery: "Yassir Arafat ist der einzige Palästinenser, der sein Volk in der jetzigen verzweifelten Situation führen kann und der die nötige Autorität besitzt, einen Frieden zu schließen."
Auf einmal war er da. Ich merkte es. weil ich plötzlich eine Spannung spürte. Er trat mit schnellen Schritten ein, umarmte einige seiner Leute. Dann kam er auf mich zu, ein breites Lächeln im Gesicht, und küsste mich auf beide Wangen. Ich hatte ihn hunderte Male auf dem Bildschirm gesehen, aber er war ganz, ganz anders. Ich habe nie einen Menschen getroffen, bei dem sich das öffentliche Image so sehr von seinem wahren Selbst unterschied wie bei Yassir Arafat. Er war größer, als ich gedacht hatte. Seine Augen, die auf dem Fernsehschirm wild und fanatisch blitzen, sind in Wirklichkeit warm und ruhig. Er hat fleischige, weiche Lippen. Seine Hände sind klein, weiß, fast zartgliederig. Er trug einen gut gebügelten khakifarbenen Kampfanzug und auf dem Kopf eine khakifarbene Soldatenmütze, die er bald abnahm. Er setzte sich mit mir auf ein Sofa. Nach ein paar Minuten fühlte ich mich, als ob wir uns seit Jahren kannten. Es war schwer zu glauben, dass ich der erste Israeli war, mit dem Arafat jemals offiziell gesprochen hat. Es war im Juli 1982. Das Gespräch fand in einer belagerten Stadt statt, mitten im Kampf. Arafat und ich waren offiziell Feinde. Eine Stunde vorher hatte ich mich von Ost- nach Westbeirut eingeschlichen. Ich musste durch die Fronten von vier Armeen, um zu den palästinensischen Stellungen zu gelangen. Von dort wurde ich durch die zerschossene Stadt in eine Privatwohnung gebracht. Um uns herum bildete sich bald ein Kreis von Mitarbeitern mit ihren Frauen und Kindern. Andere kamen hinzu, als sie von diesem unglaublichen Treffen erfuhren. Die Atmosphäre war ganz ungezwungen, informell. Gefolgsleute unterbrachen Arafat, machten Bemerkungen, korrigierten sein Englisch. Und trotzdem war in jeder Sekunde zu spüren, welche Autorität Arafat ausstrahlte. Man scherzte, Arafat versuchte sogar, etwas Hebräisch zu sprechen. Aber in diesem Moment glaubte Arafat ebenso wie ich, ebenso wie eigentlich jeder, dass Ariel Scharon, damals Verteidigungsminister, im Begriff war, Westbeirut anzugreifen, um die dortigen PLO-Truppen zu vernichten und Arafat umzubringen. In eben diesem Augenblick waren mit Sicherheit Hunderte von israelischen Agenten in der Stadt auf der Suche nach ihm. Eine Art Euphorie lag in der Luft, wie Menschen sie spüren, die wissen, dass sie jederzeit sterben können, dass ihre Überlebenschance nicht mehr in ihrer Macht, sondern in den Händen Allahs oder Jehovahs oder des schlichten Schicksals liegt. Ich habe diese Euphorie selbst gespürt, als ich im Unabhängigkeitskrieg 1948 Frontsoldat war. Vor ein paar Wochen traf ich Arafat erneut, wieder in einer belagerten arabischen Stadt. Diesmal war es Ramallah. Wieder war der Ort von israelischen Panzern umzingelt. Und wieder war es Ariel Scharon, der entschlossen war, Yassir Arafat umzubringen, diesmal als israelischer Premierminister. Und wieder musste ich mich durch Armeeposten einschleichen. 20 Jahre sind seit unserem ersten Treffen verstrichen. Ich habe ihn in der Zwischenzeit oft getroffen, in Tunis, Europa und Gaza. Ich habe ihn in vielen Situationen erlebt. Aber Arafat in seinem zerschossenen Hauptquartier in Ramallah, in unmittelbarer Lebensgefahr, erinnerte mich an den alten Kämpfer, den ich in Beirut getroffen hatte. Dieselbe Euphorie, dieselbe Fähigkeit, gerade in der bedrohlichsten Situation am besten zu funktionieren. Das Zittern seiner Lippen und Hände, das man in den letzten Jahren so oft bei ihm sehen konnte - es war verschwunden. Er machte Scherze und zeigte mir am Fenster die Panzer, die 50 Meter entfernt ihre Kanonenrohre auf sein Zimmer gerichtet hatten. In Beirut war seine Lage verzweifelt. Jetzt ist sie es vielleicht noch mehr. Die USA haben sich bedingungslos auf die Seite Scharons geschlagen, ein ungeheurer Propagandaapparat brandmarkt Arafat täglich als korrupten Tyrannen, blutrünstigen Terroristen und habituellen Lügner. Die Welt schaut gespannt zu, wie bei einem Fernsehschauspiel. Wird sich der politische Fuchs wieder aus der Falle retten? Oder wird es Scharon diesmal doch gelingen, ihn umzubringen? Wird Präsident Bush es zulassen, dass er liquidiert wird? Und wenn das passiert - wird dann die arabische Welt explodieren? Seit 43 Jahren verkörpert Arafat den palästinensischen Befreiungskampf. Er hat unzählige Krisen und Dutzende von Anschlägen überlebt und ist heute, neben Fidel Castro, der Regierungschef, der sich am längsten auf der Weltbühne bewegt. Als er Ende der 50er Jahre die Fatah-Bewegung - und damit die moderne palästinensische Nation - gründete, war Eisenhower in den Vereinigten Staaten und Ben-Gurion in Israel an der Macht. Seitdem hat er neun amerikanische und neun israelische Regierungschefs überlebt. Als er seine ersten Schritte machte, war der Name Palästina von der Landkarte und im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit verschwunden. Heute gibt es wohl kaum jemanden, der zumindest das Recht der Palästinenser auf ihren eigenen Staat bestreitet. Und das ist zum großen Teil Arafats Verdienst. Wer ist dieser Mann? Wenige kennen ihn wirklich. Besonders für westliche und israelische Beobachter bleibt er rätselhaft, weil er, ein typischer Araber, einer Kultur angehört, die ihnen verschlossen ist. Tatsächlich aber ist es leicht, ihn zu verstehen, wenn man die besondere Lage des palästinensischen Volkes kennt. Arafat ist kein Intellektueller, aber sehr intelligent. Er begreift Zusammenhänge blitzschnell, wobei er sich mehr von seiner Intuition denn seiner Logik leiten lässt. Er wirkt durch den persönlichen Kontakt, er sucht die körperliche Nähe. Auf typisch arabische Weise benutzt er große Gesten, um zu überzeugen. Das entspricht der israelischen Mentalität überhaupt nicht. Sein Gedächtnis ist unglaublich. Ein kleines Beispiel: Am Ende unseres ersten Gesprächs in Beirut fragte ich ihn, wo er hingehen würde, falls er lebendig aus dem Libanon herauskäme. Er antwortete trotzig: "Was heißt wohin? Nach Hause!" Ich lächelte innerlich. Dreizehn Jahre später kam er tatsächlich nach Gaza. Am ersten Tag dort, gegen Mitternacht, lud er mich zu sich ein. Ich wartete in einem großen Saal, der gefüllt war mit arabischen Journalisten. Als er hereinkam und mich sah, kam er direkt auf mich zu, umarmte mich und flüsterte mir etwas ins Ohr. Die Journalisten waren neugierig: was hat der Ra'is, der Chef, diesem Israeli so vertraulich gesagt? Tatsächlich waren seine Worte: "Was hab ich dir in Beirut prophezeit? Jetzt bin ich zu Hause!" Arafat wird mit seinem Befreiungskampf oft mit Nelson Mandela verglichen, der in Europa sehr populär ist. Aber dieser Vergleich hinkt. Arafats Aufgabe ist ungleich schwerer. Mandela saß 28 Jahre im Gefängnis. Er musste nicht draußen kämpfen. Arafat dagegen war zu dieser Zeit an den Kämpfen beteiligt und wurde als Terrorist abgestempelt. Mandela kämpfte gegen ein international verhasstes Regime. Arafat kämpft gegen ein jüdisches Besatzungsregime, das sich mit den Opfern des Holocausts identifiziert, und dem gegenüber ganz Europa und Amerika ein schlechtes Gewissen verspürt. Nach dem Zusammenbruch des Apartheid-Regimes übernahm Mandela einen reichen, funktionierenden Staat. Als Arafat dagegen in die besetzten palästinensischen Gebiete einzog, fand er nichts - keine nennenswerte Wirtschaft, so gut wie keine Infrastruktur. Er musste unter schwersten Bedingungen alles neu schaffen. Die Palästinenser konnten zwar nach dem Oslo-Abkommen, in dem sie auf 78 Prozent des Landes Palästina verzichtet haben, einen kleinen quasi-Staat errichten, aber ihr Befreiungskampf ist noch lange nicht am Ziel. Der größte Teil ihrer Gebiete ist weiterhin besetzt, auch in ihrem "Staat" bleiben sie vollkommen von Israel abhängig. Verhandlungen führen zu nichts. So entsteht eine beispiellose Situation: Arafat ist gleichzeitig der Führer eines Befreiungskampfes und Chef eines quasi-Staates. In einer Befreiungsorganisation braucht man eine autokratische Führung, die schnell Entscheidungen treffen kann. So hat Arafat beispielsweise 1974 den historischen Beschluss gefasst, die palästinensischen Ziele durch Frieden mit Israel zu erreichen. Dafür hätte er damals nie eine Mehrheit im eigenen Volk gefunden. So eine Bewegung kann auch nie wirklich demokratisch sein. Geldquellen und Ausgaben einer revolutionären Bewegung müssen geheim sein, unabhängige Gerichtsbarkeit ist in ihr unmöglich. Sie muss List, Gewalt und Diplomatie benutzen. Und all das ist das Gegenteil von dem, was man von einem demokratischen Staat verlangt. Es gibt palästinensische Intellektuelle, die Arafat deswegen beschuldigen, kein demokratischer Regierungschef zu sein. Das stimmt wohl - aber die Palästinenser sind noch weit davon entfernt, überhaupt einen Staat zu haben. Sie kämpfen jetzt buchstäblich um ihr Leben als Nation und als Menschen, sie stehen in akuter Gefahr, aus ihrem Land vertrieben zu werden. Nach mehr als 40 Jahren ununterbrochenen Kampfes ist Arafat sicher kein großer Demokrat und sicher kein idealer Staatschef. Aber er ist der einzige Palästinenser, der sein Volk in der jetzigen verzweifelten Situation führen kann und der die Autorität hat, nicht nur einen Frieden zu schließen, sondern auch sein Volk zu überzeugen, ihn zu akzeptieren. Wenn es Scharon gelingen würde, ihn umzubringen, wäre es eine Katastrophe für Palästina, für Israel, für den Frieden, für die ganze Welt. Der israelische Publizist und Friedens-Aktivist Uri Avnery hat Yassir Arafat erstmals 1982 getroffen - und danach immer wieder, zuletzt, vor ein paar Wochen, in Ramallah. Avnery wurde 1923 als Helmut Ostermann im westfälischen Beckum geboren. Nach der Machtergreifung der Nazis wanderte er mit der Familie 1933 nach Palästina aus. Seit 1948 setzt er sich für die autonome Existenz eines palästinensischen Staates neben Israel ein.Daoud Kuttab: "Yassir Arafat ist eine zwiespältige Persönlichkeit. Manche nennen ihn sogar einen Lügner. Menschen aus seiner nahen Umgebung bekommen zumindest selten eine klare Antwort."
1994 begegnete ich Yassir Arafat zum ersten Mal, nachdem ich mich über längere Zeit um ein Gespräch mit ihm bemüht hatte. Unsere Begegnung in seinem Büro in Tunis dauerte nicht lange. Denn nur kurz, nachdem wir nach Mitternacht zusammengekommen waren, kippte das Gespräch. Arafat brauste auf, wenn ich ihn unterbrach, reagierte ungehalten auf meine Fragen. Ich hatte von ihm wissen wollen, ob sich eines Tages Arafats Fatah-Bewegung in eine Partei wandeln würde. Da beendete der Palästinenserführer das Interview abrupt. Erst später wurde mir klar, dass Arafat mich für eine Botschaft an die jungen Fatah-Führer benutzt hatte, die mit uns im Raum saßen, während wir sprachen. Er wollte deutlich machen, dass seiner Meinung nach die Fatah keine Partei werden kann, weil sie eben eine Bewegung ist, die für die Hoffnung der Palästinenser auf Freiheit und Unabhängigkeit steht. Ein paar Jahre später kreuzten sich unsere Wege wieder, diesmal in Gaza. Er war gerade von der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens zurückgekehrt. Wir trafen uns bei einer Konferenz über die Zukunft des palästinensischen Fernsehens und Abu Ammar, wie Arafat gerne genannt wird, zeigte sich überaus charmant. Er hatte einige Mühen auf sich genommen, damit wir uns treffen konnten, und drückte mir gegenüber seine Unterstützung für meine Arbeit als Journalist aus. Es schien mir, als wolle er sich dafür entschuldigen, dass er damals so brüsk mein Interview mit ihm abgebrochen hatte. Arafat hat die Fähigkeit, einem das Gefühl zu geben, er widme einem seine ganze Aufmerksamkeit. Er kann sehr warmherzig sein, fragt oft nach, wie es einem geht, lädt zum Essen ein. Sein Charme hielt, was mich betrifft, allerdings nicht lange. 1997 strahlte die Fernsehstation, die ich betreibe - Al Quds Educational Television - eine Sendung über die Sitzung des palästinensischen Parlaments aus, die sich mit Korruption befasste. Anschließend befahl Arafat meine Inhaftierung. Sieben Tage später wurde ich wieder entlassen - ohne dass ich je eine Erklärung für den Grund meiner Festnahme erfahren hätte. Die Polizei behandelte mich in der Haft ausgesprochen sanft. Als ich meinen Wärter fragte, warum ich diese Sonderbehandlung bekäme, antwortete er, dass er dazu die Anweisung bekommen hätte. Obwohl er mich ins Gefängnis gebracht hatte, hatte mir Arafat also mal wieder eine Botschaft überbringen wollen: Dass er zwar nicht sehr glücklich darüber war, was ich tat, aber mir immer noch Respekt zollte. Yassir Arafat ist eine zwiespältige Persönlichkeit, seine verschiedenen Gesichter sind ein Merkmal seiner langen Karriere. Er soll einige seiner treusten Gefährten verhaftet haben lassen - um sie dann nach ihrer Entlassung zu befördern. Und er ist kühn. In den 60er Jahren wurde der junge Arafat im Befreiungskampf eines Fehler bezichtigt. Anstatt die übliche Bestrafung für solche Vergehen zu akzeptieren, schlug er seinen Kameraden vor, eine gefährliche Mission auf sich zu nehmen. Sollte er erfolgreich sein, sagte er, dann solle er der Bestrafung entgehen. Seine Mission war erfolgreich. Das brachte ihm den Respekt seiner Kameraden ein, und er wurde der höchste Befehlshaber der palästinensischen Revolution. Im Laufe der Zeit hat sich Arafat den Ruf erworben, trügerisch und irreführend zu sein. Manche nennen ihn sogar einen Lügner. Menschen aus seiner nahen Umgebung bekommen zumindest, heißt es, selten eine klare Antwort. Palästinenser scherzen oft über die verschiedenen Stifte, mit denen er seine Zahlungsaufträge unterschreibt. Es hält sich das Gerücht, dass sein Schatzmeister der einzige sei, der weiß, wann Arafat wirklich will, dass eine Person bezahlt wird, und wann nicht. Wie er das erkennt? Anhand der Füllerfarbe, mit denen die Schecks unterschrieben sind. Diese Anekdote zeigt, dass der Palästinenserführer oft unfähig ist, klare Auskunft zu geben. Arafat ist einfach nicht dafür bekannt, sich schnell zu entscheiden. Wenn er gezwungen wird, eine Antwort zu geben, versucht er, sie mit verschiedenen Taktiken hinauszuzögern, um ja kein entschiedenes Ja oder Nein geben zu müssen. In den 80er Jahren prägten die Palästinenser das Wort "Laam", um diese Haltung auszudrücken. Das Wort ist eine Kombination der arabischen Wörtern für Ja und Nein. Im Laufe der Jahre hat Arafat mehr Kritik auf sich gezogen als jeder andere Führer in der gesamten Region. Er ist von einzelnen, aber auch von Gruppen des gesamten palästinensischen und arabischen politischen Spektrums immer wieder attackiert worden. So oft, dass kein anderer politischer Führer diese erdrückende Last der wütenden Vorwürfe überlebt hätte. Aber irgendwie hat er all diesen Schwierigkeiten standgehalten. Einer seiner Biografen geht so weit, ihn deswegen als "Teflon Guerilla" zu bezeichnen. Weil der Palästinenserführer es immer wieder schafft, dass alle Vorwürfe an ihm abperlen wie bei einer gut beschichteten Bratpfanne. Eines der Ereignisse, an denen der widersprüchliche Führungsstil von Arafat auch in der Öffentlichkeit zu beobachten war, war der Tag, an dem die Palästinenser und Israelis das Taba-Abkommen unterzeichneten. Dieses Abkommen von 1995 befasste sich damit, wie das Oslo-Abkommen im Detail umzusetzen sei. Nachdem die Verhandlungsführer in mehreren aufeinander folgenden Nächten kaum eine Minute Schlaf gefunden hatten, wurde der Presse mitgeteilt, dass man zu einem Ergebnis gekommen sei. Am Morgen sollten die Dokumente unterschrieben werden. Der Konferenzraum füllte sich mit Journalisten, Satelliten-Übertragungswagen standen bereit, die Regierungschefs kamen endlich an und jeder erwartete, dass es nun endlich losgehen sollte. Aber Arafat hatte anderes im Sinn. Er machte keine Anstalten, zu unterzeichnen. Gespräche am Rande begannen, zwischen der israelischen, amerikanischen und ägyptischen Delegation. Nachdem Stunden vergangenen schienen, war Arafat bereit. Aber erst, nachdem er noch etwas auf die Dokumente gekritzelt hatte. Es ist nie bekannt geworden, ob das, was Arafat noch schnell auf die Dokumente geschrieben hat, verbindlich gewesen ist oder ob er dies vor den Augen der Weltöffentlichkeit nur gemacht hatte, um seinen Leuten zu zeigen, dass er keiner ist, der so leicht einlenkt. Wie auch immer - diese Aktion in letzter Minute ist nur ein weiteres Puzzle-Stück zu dem Bild, das dieser rätselhafte Führer abgibt. Es gibt verschiedene Interpretationen, warum Arafat selten eine klare und ehrliche Antwort geben kann, egal zu welchem Thema. Manche glauben, dass er dieses Verhalten schon an den Tag legte, als er in Ägypten lebte, wo er aufgewachsen ist. Andere sagen, dass der Palästinenserführer einfach gezwungen ist zu lügen und zu tricksen, weil die palästinensische Position so schwach ist. Ghassan Andoni, ein Professor an der Bir-Zeit-Universität und ein anerkannter politischer Analyst, sieht das ähnlich: "Israel und die USA verdienen jemanden wie Arafat, der sich nicht in die Karten schauen lässt. Weil sie gegenüber den Palästinensern auch ständig tricksen und versuchen, Unterdrückung und Besetzung zu rechtfertigen. Also versucht auch Arafat, keinem Abkommen zuzustimmen, das nach seinem Gefühl ungerecht zu seinem Volk ist." Als das Oslo-Abkommen dem palästinensischen Nationalrat 1994 in Algier präsentiert wurde, waren viele PLO-Aktivisten unglücklich darüber. Nach einer langen Abfolge von Reden, die sich alle gegen das Abkommen richteten, stand Yassir Arafat auf und hielt eine Rede, in der er die Mängel in dem Abkommen mit den Israelis zugab. "Ich kann 200 Dinge aufzählen, die falsch sind an diesem Abkommen", sagte er. Aber er fügte hinzu: "Das ist das Beste, das wir zu diesem Zeitpunkt bekommen können." Israelis und Amerikaner haben lange Zeit Arafats Tricksereien gebilligt, auch wenn sie nichts Gutes verhießen. Sie waren willens, sich ihm so lange anzuschließen, so lange sein Ziel ein dauerhafter Frieden zu sein schien. Doch das ist nun vorbei. Als die Selbstmordattentate begannen, beschuldigten die Israelis Arafat, er würde zu solchen Anschlägen ermutigen. Manche gingen sogar weiter und behaupteten, er hätte direkt die Anschläge gegen Israel unterstützt. Und die Rede des amerikanischen Präsidenten George Bush, in der dieser kürzlich die Absetzung der palästinensischen Führung unter Arafat gefordert hatte, klang wie ein direkter Affront gegenüber dem Palästinenserführer. Obwohl Arafat schon lange unter einer brutalen militärischen Besatzung leidet, war er selten so direkt internem und externem Druck ausgesetzt, der sich gegen seine Person richtet. Es ist schwer einzuschätzen, inwieweit sich der Palästinenserführer - in den Nachwehen des 11. September, und dem so genannten Krieg gegen den Terror - den direkten Angriffen auf seine Person entziehen kann. Arafat hat in der Vergangenheit ähnliche Schwierigkeiten überstanden. Wird er sie diesmal auch wieder überstehen? Schwer zu sagen, aber wie Arafat oft selbst gesagt hat: Palästina ist ein heiliges Land und Wunder hören nie auf an so einem geheiligen Ort. Daoud Kuttab, 47, ist einer der profiliertesten palästinensischen Journalisten und kämpft seit Jahren für eine unabhängige Presse, was ihm immer wieder Schwierigkeiten mit Arafat eingebracht hat. Er ist Direktor des Institute of Modern Media an der Al Quds Universität in Ramallah.Frankfurter Rundschau, 27.7.2002